Erzählungen aus dem Nachlass
Band 13 als PDF mit Lesezeichen
Band 13 als PDF in Druckversion
Band 13 als E-Book im epub-Format
Band 13 als E-Book im mobi-Format
Inhaltsverzeichnis
Frau Holderlein
Der Geheimrat Zet
Der Selbstmörder
Die schöne Magd
Ambros
Das Erbbegräbnis am Lech
Schule der Höflichkeit
Das Goldstück
Der Sekt der Geizigen
Komödiantengeschichte
Das hinkende e
Die Mückenschlacht
Im brennenden Feuerofen
Die Könige sind unterwegs
Der gemalte Sommer
Das bosnische Mahl
Die albanische Hühnerfahrt
Die sizilianische Vesper
Der Grasgarten
Klage eines weißen Mannes
Die Taubenfedern
Tausend Rehe
Schnee überm Oktoberfest
Lob der Stadt Passau
Regensburg
Editionsnotiz
Drucknachweise und Anmerkungen
Frau Holderlein
Es gibt Menschen, von denen man es sich nicht vorstellen kann, daß auch sie einst wie Kinder hüpften: Zu diesen gehörte Frau Holderlein. Sie war groß, sie war dick und bewegte sich langsam. Elfenzart waren ihre Knöchel und ihre Füße so klein, daß man sich wunderte, wie sie die Last des schwer gewordenen Körpers tragen konnten. Ihre üppige Brust war in Seide gehüllt, immer in Seide, und in den Farben war sie nicht wählerisch – heute taubenblau und morgen tomatenrot, das machte ihr keine Bedenken. Im Gesicht sah sie südländisch aus, mit quittengelber Haut, wer weiß, woher sie die hatte, sie, einer bayerischen Mutter Kind. Eine krumme Geiernase saß über ihrem kleinen, zugespitzten Mund, der auf der Oberlippe einen dunklen Flaum hatte. Ihre schwarzen Augen glühten, in ihre schwarzen Haare mischten sich weiße Strähnen, der weißen Strähnen wurden es immer mehr, das Schwarz wurde immer weniger, aber ganz weiß wurde sie nie. So war Frau Holderlein, jeder kannte sie.
Ihr Mann, Herr Holderlein, war Pferdemetzger, und nebenbei auch Pferdehändler, und augenzwinkernd sagten seine Freunde, mit dem Roßhandel verdiene er mehr als mit der ganzen Metzgerei. Die betrieb er in der Münchner Vorstadt, in dem alten, fast noch ländlichen Giesing, und seine Pfefferwürste waren weithin berühmt. Sie waren schwarz, gelbe Fettwürfel waren darin, und Pfefferkörner, darauf zu beißen man sich in acht nehmen mußte, das tat den Zähnen weh. Für zehn Pfennige bekam man ein Stück, das war länger als eine Hand lang, und als Zuwaage noch eine daumendicke Scheibe. Die Wurst war herrlich, und hatte nur einen Fehler – die Haut ließ sich schwer lostrennen. Die Lehrlinge, und auch die Schüler, die sich von ihrem Taschengeld die Wurst gern kauften, die ärgerten sich nicht lang mit der schwer abziehbaren Hülle und aßen sie mit. Die Pferdezungen gingen in bessere Häuser. Man weiß es: geräucherte Pferdezungen sind eine Köstlichkeit und übertreffen die Ochsenzungen an Wohlgeschmack. Manche Menschen freilich sind kleinlich und weigern sich, etwas, das vom Pferde stammt, zu essen. Ihnen, die das Vorurteil nun einmal haben, darf man nicht sagen, daß es Pferdezunge ist, was sie auf dem Teller haben, dann brechen sie in Lobschreie aus. Sie sagen, diese Voreingenommenen, gegen das Pferd hätten sie nichts, aber was unter das Beil eines Pferdemetzgers käme, seien alte, und oft auch kranke Tiere, abgerackerte Droschkengäule und Schindmähren. Dagegen verwahrte sich Herr Holderlein und sagte, er schlachte nur gute Stücke, verunglückte Gäule, und es gäbe überdies eine amtliche Fleischbeschau, die nur einwandfreies Fleisch zum Verkauf zuließe. Und ob vielleicht eine rippendürre Kuh besser zu essen sei als ein Hengst, der sich das Bein gebrochen? So zürnte er und fragte wohl auch herausfordernd, ob sie denn nie gehört hätten, daß Schmalzgebackenes am besten im gelben Pferdefett geriete? Nun, sie seien eben keine Feinschmecker!
Sie waren angesehene Leute in der Vorstadt, die Holderleins. Das kleine Haus, in dem sie wohnten und die Pferdemetzgerei betrieben, gehörte ihnen, und ihre Ehe war glücklich und kinderlos. Gegen den Hof hinaus hatte Herr Holderlein einen Stall angebaut, in dem er sich ein eigenes Pferd hielt, einen feurig-schnellen Rotfuchs mit einem weißen Fleck auf der Brust. Das Tier war sein ganzer Stolz. Auch einen kleinen Wagen besaß Herr Holderlein. Seit dreißig Jahren waren sie nun verheiratet, und bei ihrer silbernen Hochzeit war es hoch hergegangen. Reich geschmückt war die Tafel gewesen, auf einem Schragen hatte man ein Faß Bier aufgelegt, und der Lehrling der Metzgerei machte den Schenkkellner: schäumend flossen die Krüge über. Aber auch Wein gab es, weißen und roten, und zuletzt Sekt aus hohen Stengelgläsern, die klingend gegeneinanderstießen. Das klang wie Geläut von Pferdegeschirren, sagte Herr Holderlein, der Silberbräutigam. Frau Holderlein hatte stolz und beglückt im Kreis der Versammelten herumgeschaut, von Erinnerungen bedrängt. Sie trug ihre schönste Bluse aus weißer, starrender Seide und hatte ein Myrthenkränzlein im hoch emporgedrehten Haar, und dem Sekt sprach sie fleißig zu. O, die schöne Lustbarkeit! Der kleine, stämmige Herr Holderlein trug den schwarzen Gehrock, den er schon bei der grünen Hochzeit getragen hatte, und ein Sträußlein im Knopfloch. Er war nicht dicker geworden, rühmte er sich und spannte die Brust. Seine Frau neben ihm war wie eine hohe weiße Lilie, feierlich sah sie aus und fromm.
Herr Holderlein war ein listenreicher Schafkopfspieler, ein Meister in allen Schlichen und Tücken dieser Kunst, und jeden Abend, und keinen ließ er aus, ging er ins Wirtshaus, reihum, immer in ein anderes, die Karten klatschend und siegreich auf den Tisch zu werfen, der Schrecken seiner Gegner. Da gab es oft hochrote Köpfe, denn auch mit dem Hohn über die Unterliegenden sparte der Spielmeister nicht, und manchmal auch Zank, der aber immer bald wieder geschlichtet wurde. Selten kam es vor, daß er verlor – er tat es dann in würdiger Haltung und nahm Spottreden gelassen hin. Herr Holderlein hielt es mit dem Ausgehen wie die andern Geschäftsleute ringsum, die auch jeden Abend am Wirtshaustisch saßen – die Frauen wußten es gar nicht mehr anders, auch Frau Holderlein nicht. Das war nun einmal so Sitte. Und es mußte so sein, sagten die Männer ihren Frauen, der Wirt will doch auch ein Geschäft machen und kauft dafür bei uns ein, sagten sie – eine Hand wäscht die andere.
So gab es viele einsame Stunden für Frau Holderlein, aber sie litt nicht darunter. Abends saß sie in ihrem Wohnzimmer, neben der Topfpalme, vor einem Henkelkrug dunklen Biers, und die Lampe gab ein friedliches Licht. Die Lampe war ein besonders schönes Stück, das Herr Holderlein bei einer Versteigerung erworben hatte. Sie stellte ein im Galopp dahinsprengendes Pferd vor. Sie war aus Kupfer, wild wallte die Mähne, und der Roßschweif bog sich schön. Der Künstler, der sie gefertigt hatte, mußte ein erlesener Pferdekenner gewesen sein, behauptete Herr Holderlein. Zierlich und zornig war der Kopf, die Nüstern blähten sich, schön waren die Beine gearbeitet, und die Augen waren aus grünem Glas und blitzten. Im Bauch hatte das Tier Petroleum. Frau Holderlein liebte das kupferne Tier und hielt es glänzend blank. Wenn sie häkelte oder strickte oder an einer neuen Seidenbluse nähte, sah sie oft zärtlich und bewundernd zu ihm auf. Sie las oft in einem Fortsetzungsroman, der von Heft zu Heft unendlich und aufregend sich fortspann, oder auch gern und immer wieder im ägyptischen Traumbuch, denn auf Träume gab sie viel und wußte sie schön auszulegen. Die Nachbarinnen kamen zu ihr, das, was sie geträumt hatten, sich deuten zu lassen. Sie war zum Fürchten in solcher Stunde, wenn der Geist über sie kam, und gläubig lauschten die Frauen den Worten der seidenen Sybille.
Und als das Ehepaar so fast vier Jahrzehnte in Freud und Leid zusammen verbracht hatte, kam Herr Holderlein zu sterben. Es war ein langwieriges Krankenlager, das er zu überstehen hatte, und Frau Holderlein pflegte ihn mit hingebender Geduld. Herr Holderlein war recht kleinmütig geworden, als er sein Ende herannahen fühlte. Er hatte Stunden, da er weinte, so leicht zu rühren war jetzt sein Herz. Und einmal, als ihn die Frau eben frisch gebettet hatte und das Kopfkissen tätschelte, darauf sein Haupt ruhte, und sie ihm die Tropfen einflößte, die vergeblichen, und friedlich leuchtete das Petroleumpferd, da sah er sie, die ihm so gut tat, mit nassen Augen an und sagte: »Wenn ich jetzt fort muß, gell, du läßt mich nicht allein, du gehst mit!« Herr Holderlein hatte wohl nie etwas von der strengen Sitte der indischen Witwenverbrennung gehört, die da verlangt, daß, wenn der Ehemann stirbt, die Ehefrau freiwillig den Scheiterhaufen besteigt, im Tode sich dem Mann zu vereinigen, dem sie im Leben gesellt war. Aber sein Wunsch war ähnlicher Art. Frau Holderlein doch war kein indisch Weib. Ganz freundlich sah sie ihren Eheherrn an, und es war kein Groll in ihrer Stimme, und auch keine Verwunderung ob des sonderbaren Ansinnens, und wie man einem Kinde, das man nicht ernst nimmt, einen törichten Wunsch abschlägt, sagte sie voll Sanftmut: »Ja, freilich! Vierzig Jahre lang bist du jeden Abend allein ausgegangen, und hast mich nicht gebraucht, und jetzt auf einmal soll ich mitgehen!« Still war es im Zimmer, nur der Regen klopfte. Frau Holderlein schraubte den Docht der Lampe niedriger, daß den Kranken das Licht nicht blende und sagte: »Jetzt schlaf« Herr Holderlein seufzte leise und dann schlief er ein, für diese Nacht, und ein paar Tage darauf für immer. In tiefer Trauer überlebte ihn seine Witwe um fünf Jahre. Viele, viele Abende, die nicht leerer waren, als sie es sonst gewesen, saß sie unter der Lampe und hatte keine unnützen Gedanken. Die Metzgerei verpachtete sie, nicht ohne es zur Bedingung zu machen, daß sie jeden zweiten Sonntag eine Pferdezunge umsonst zu bekommen habe. Das hielt der Pächter treulich ein. Das Pferd, es war schon längst der Rotfuchs nicht mehr, verkaufte sie und auch das Wägelchen, in der Wohnung blieb sie. Sie war immer fromm gewesen, jetzt ging sie täglich zur Frühmesse, und oft zu Herrn Holderleins Grab.
Und was sie früher schon gelegentlich getan, das kam erst jetzt zu voller Entfaltung. Wenn jemand starb, eine alte Frau, von der es nicht anders zu erwarten gewesen war, oder eine junge Frau im Wochenbett, oder ein schwindsüchtiges Mädchen, dann holte man sie herbei. Kamm und Bürste packte sie in ihre Tasche, und Öl und Salben, und eine Brennschere und eilte zu dem Trauerhaus. Eifrig begann sie ihr Geschäft, das sie um Gotteslohn verrichtete, kein Geld nahm sie dafür. Mit zarten Fingern löste sie der Toten das Haar und lobte es, wenn es schön und dicht war, und kämmte und bürstete es und legte es behutsam zurecht. Sie nahm die Brennschere und machte sie im Ofenfeuer oder über einer Kerzenflamme heiß und prüfte an einem Streifen Zeitungspapier, ob das Eisen nicht zu glühend sei, und brannte der Toten Wellen und Stirnlöckchen, zierlich gerollt auf der bleichen Haut – kein Haarkünstler hätte es besser machen können. Und manche Mutter sagte, die tote Tochter betrachtend: »Wie ein Engel schaut sie aus!« und weinte sanfter.
An Männern übte sie das fromme Werk nicht, nur einmal tat sie es. Am Rand von Giesing, wo dann das flache Bauernland beginnt, stand eine große Ziegelei, in der viele Italiener arbeiteten. In Jacken und Hosen aus Rippelsamt kamen sie daher, die Männer aus dem Süden, aus Udine oder aus Neapel, wo der Vesuv brennt. Von den Südländern waren die meisten Kunden der Pferdemetzgerei, auch Alfredo, ein junger, zarter Mensch mit fast noch kindlichen Gesichtszügen. Mit schwungvoller Demut, wie vor einer Königin, zog er den Hut, wenn er Frau Holderlein begegnete, und sie nickte gnädig zurück. Er gefiel ihr in seiner Unschuld. Nun war er unerwartet gestorben, an einem Lungenleiden, sagte der Arzt, und die Leute sagten: aus Heimweh! Seine großäugig-traurig blickende Frau kam jammernd zu Frau Holderlein, daß sie dem Toten den üppig-schwarzen Lockenkopf brenne. Und so flehentlich bat sie darum und warf sich schreiend auf die Knie vor ihr nieder und küßte ihr angstvoll und gierig die Hände und den Rocksaum, daß sie nicht »nein« sagen mochte. Aber sie betrachtete es doch als ein unziemliches Verlangen, und es wurde auch nie wieder an sie gestellt. Auch schien ihr, Herrn Holderlein wäre es nicht recht gewesen.
Als sie starb, brannte ihr niemand die Haare zu Löckchen. Die vom Amt bestellte Totenfrau beherrschte die Kunst nicht, und sie kam auch bald ganz außer Brauch.
Der Geheimrat Zet
Der Leiter eines großen Unternehmens, der Geheimrat Zet, ein behäbiger Sechziger mit großem rundem Gesicht, stattlich und breitschultrig, ein Mann, zu dem der schwarze Schoßrock und der hohe, steife Hut gut paßten, hatte nicht nur zu planen und zu werken hinterm Schreibtisch, ihm oblag auch, wie sich das versteht, die Pflicht, bei feierlichen Anlässen, traurigen und heiteren, Ansprachen zu halten, das Wort zu ergreifen, wie die Zeitungen hernach in ihren Berichten zu schreiben pflegten. Am häufigsten traf es sich, daß er bei Beerdigungen ein paar teilnahmsvolle Sätze zu sprechen, einen großen Kranz mit schwarzen, wehenden Flügelschleifen am Grab niederzulegen hatte.
Wenn das Wetter gar zu schlecht war, wenn vom Himmel der Regen niederfiel in ein offenes Grab, und um das Grab standen viele schwarze Männer und Frauen und hatten viele schwarze Schirme aufgespannt, auf die der Regen trommelte – so waren sie immerhin vor der schlimmsten Nässe geschützt, nur in das Grab fiel der Regen ungehindert – wenn das Wetter dann also gar zu schlecht war, und er hatte seine kleine Rede gehalten, der Geheimrat Zet, und hatte seinen großen Kranz niedergelegt, und war wieder zurückgetreten in den Kreis der Trauergäste, so verstand er es vortrefflich, jede Gelegenheit wahrzunehmen, sich in die zweite und dritte Reihe der Zuschauer zu schieben, unmerklich, ganz wie zufällig, bis er der hinterste und allerletzte Mann war und nur mehr schwarze Rücken vor sich sah. Dann wandte er sich, dann ging er mit raschen, freien Schritten durch die Gassen der fröstelnd nassen Grabsteine, dahin zwischen weißen Marmorengeln und gelben Säulen, zum Friedhofsausgang, stieg in seinen Wagen, setzte sich in den Polstern zurecht, und fand es doppelt warm und gemütlich mit seinem Dach über sich, wenn er sich erinnerte, daß noch immer viele schwarze, nasse Schirme über einem offenen Grab schwankten.
Diese Geschicklichkeit, vor Beendigung von Feierlichkeiten sich davon zu schleichen, und das brauchten nicht immer nur Beerdigungen zu sein, und es brauchte auch nicht immer gerade zu regnen, bildete er immer kunstvoller aus, und die am nächsten Beteiligten, die trauernden und die jubelnden, merkten fast nie seine frühe Flucht. Die merkten nur Männer in wichtigen, öffentlichen Stellungen, die, wie er auch, gezwungen waren, viele Freudenfeste und Trauerversammlungen mitzumachen – die merkten es, mit Mißbilligung manche, die neidisch waren auf diese seine füchsische Gabe, andere mit Freude über seine Schlauheit, die sie bewunderten.
Aber dann kam einmal der Tag, da schwankten wieder viele schwarze Schirme über einem offenen Grab, und im offenen Grab und vernagelten Sarg lag der Geheimrat Zet, weit über die Siebzig nun, und sein Gesicht war noch rund, aber nicht mehr rot wie ehedem, und er lag im Sarg, wie wir alle einmal im Sarg liegen werden. Der Regen fiel, unter den Schuhen der Trauergäste platschte der klebrige Lehm und schrie auf, wenn der Schuh sich hob, schrie boshaft auf, weil er den Schuh loslassen mußte, und Reden wurden gehalten, kurze und lange, gute und schlechte, und Kränze häuften sich über dem Grab, und die Feier nahm kein Ende, und wenn ein Windstoß ging, fand der Regen trotz der Schirme seinen Weg in die Gesichter.
Einer, der oft den lebenden Geheimrat Zet hatte in solcher Stunde fuchsschlau entwischen sehen, einer, der den großen, schweren Mann gern gehabt hatte, legte die Hand im schwarzen Leder vor den Mund und flüsterte lächelnd und mit einem sonderbaren Zucken um die Augen seinem Nachbarn mit einem Kopfnicken auf das offene Grab hin zu: »Heut muß er aber bis zuletzt da bleiben!«
Wahrhaftig, heut blieb er bis zuletzt, der Geheimrat Zet, trotz der vielen Reden und des vielen Regens, aber ein guter Sarg ist besser als der beste Schirm, und Regen und Reden gleiten von ihm ab.
Der Selbstmörder
Der Arzt hatte eine schlimme Krankheit festgestellt, und es war klar, daß er sich töten würde. Wenn er schon fort mußte, geradezu aufdringlich wollte er nicht sein. Nur nicht warten, bis ihn die giftgrünen Säfte zersetzten wie Regenwasser die Mausleiche. Wenn er sich behorchte, vernahm er ein inwendiges Brausen und Rauschen, das nichts Gutes bedeuten konnte. Gelbes Wasser, dachte er, gelbes Flutwasser, das Mauern und Balken zernagt, bis das Haus zusammenstürzt. Lieber eine schöne runde, schwarze Mine legen und sie entzünden. Wenn die glühenden Balken rote Kurven am Himmel beschreiben, haben sie noch einen feurigen Purzelbaum geschlagen, ehe sie im kalten Kellerwasser ersaufen. Er besann sich: Sterben konnte nicht schwer sein. Ein Tag lief dem andern nach, und wenn man dem letzten ein Bein stellte, daß er kräftig hinschlug, war das lächerliche Wettrennen zu Ende. Er spürte leise Schadenfreude, daß er dem regelmäßigen Verlauf der Krankheit ausbiegen und einen Schlußpunkt setzen würde, wo das ordnungsliebende Schicksal noch einige überflüssige Neben- und Nachsätze zu schreiben für notwendig hielt.
Auf einer Ansichtspostkarte, die Hermann und Dorothea von einem Kranz von Tauben umflattert darstellte, teilte er seiner Geliebten mit, daß er einen längeren Abstecher nach dem Monde unternehmen werde. Bei günstigen Ansiedelungsbedingungen werde er sich dort wohl dauernd niederlassen. Dann löste er eine Fahrkarte dritter Klasse nach dem Vorort, in dessen Nähe er den Absprung in die Milchstraße wagen würde. Das Abteil saß voll schwatzender Menschen, deren Gespräche er nicht ohne Neugierde belauschte. Sie schienen sich auf hindostanisch zu verständigen und waren ohne erkenntlichen Grund sehr erregt. Vor einem jungen Mädchen, das ihn mit spitzen Augen aufspießte, zog er knurrend die Unterlippe von den Zähnen. Das blonde Ding warf ihm noch beim Aussteigen erschrockene Blicke zu, als er schon mit langen Schritten nach dem Walde ging, der schwarz schraffiert gegen den Horizont stand.
Die Sonne wollte untergehen und warf Feuerkugeln in die Kornfelder. Der Staub, der in Spiralen aufwirbelte, zeigte ihm die Landschaft unter einem dünnen Schleier, den er mit dem Stock nicht zerreißen konnte. Es hatte sich jetzt seiner eine sonderbare Unruhe bemächtigt, die nichts mit Furcht gemein hatte. Es war ihm, als müsse er sich beeilen, unverzüglich zu tun, was notwendig war. Als säße er in einem Ballon, dessen Stricke schon abgeschnitten waren, bis auf einen. Er spürte ungeheuren Auftrieb, Zwang in die Höhe, und die Erlösung lag bei einem raschen Axthieb. Kleine, spitzkielige Wolken segelten über ihn hinweg. Er versuchte mit ihnen zu fliegen. Die Arme warf er wie Flügel und stieß die Knie nach oben. Aber er fiel wieder zur Erde zurück. Zorn brandete in ihm wie eine rote Welle hoch, und er begann zu laufen. Aber immer war die Straße schneller als er und stets vor ihm. Am Himmel höhlte sich ein großes, schwarzes Loch aus. Er zweifelte nicht, daß er da hindurch müsse und stemmte die Ellenbogen steil von sich ab, um an den Wolkenrändern emporzuklimmen. Als er es mit dem Oberkörper schon geschafft hatte und mit Befriedigung dünnere Luft einatmete, zog ihn eine Faust an den Beinen zurück. Er fluchte und lief rascher, bis ihn der Wald aufnahm.
Der Boden war mit Fichtennadeln gepolstert, die den Schritt unhörbar machten. Die Bäume krümmten sich zu verzerrten Bögen und Kreisen wie die Zahnräder einer Uhr. Sie griffen mit Knirschen ineinander und schoben sich vorwärts, während er jeden Augenblick glaubte, zerrissen zu werden. Ein Reh, das ihm über den Weg lief, blieb plötzlich stehen und wandelte sich zu einem Busch, der mit braunen Blättern glänzte. Holztauben flatterten vor ihm auf. Am Rande der Lichtung stand ein Ahorn, unter dem er atmend hielt. Er zog den Strick aus der Tasche, und knüpfte ihn sorgfältig über den Ast, der wie ein Wegweiser vom Stamm abragte. Als er den Kopf in die Schlinge legte und schaukelnd in der Luft hing, begann er wieder zu fliegen. Diesmal gelang es. Er nahm die Richtung auf einen glühenden Stern, der wie toll um den Mond tanzte.
Die schöne Magd
Von Wirtshäusern läßt sich viel erzählen, mit einem Wirtshaus zu beginnen, ist immer ein guter Anfang, und auch diese Geschichte beginnt in einem Wirtshaus und endet aber in einem Pfarrhaus und sie nimmt ein gutes Ende. Nicht jede tut das, so lustig ist das Leben nicht, das die Geschichten liefert.
In einem ungarischen Landstädtchen, in dem auch deutschsprechende Bürger Besitz und Handelsgeschäfte hatten, gab es natürlich auch deutsche Wirtshäuser, die aber meist ungarische oder kroatische Dienstboten beschäftigten. Man kam gut miteinander aus, und einer lernte die fremde Sprache vom andern, der Herr vom Knecht und umgekehrt. Im deutschen Gasthof »Zum roten Ochsen« diente eine ungarische Magd schon seit über zehn Jahren treu und redlich und wusch das Geschirr und half der Wirtin in Küche und Keller und war ihr schier unentbehrlich geworden, meinte die dicke Frau in der stets blühweißen Schürze. Wie zwei Freundinnen fast taten sie ihre Arbeit nebeneinander, und so erschrak die Ochsenwirtin nicht wenig, als die Magd mit verlegenen Worten um ihre Entlassung bat. Sie sagte, die Magd, ihr Bruder brauche sie, der, es hatte lange genug gedauert, jetzt endlich eine eigene Pfarrei bekommen hatte, in einem Dorf, nur fünf Gehstunden entfernt vom Dienstplatz der Schwester. Die Wirtin sah es ein, daß der Bruder den Vorzug habe und mußte die Magd ziehen lassen.
Auf einem Schiefertäfelchen rechnete sie umständlich aus, was die Magd noch zu fordern habe an Lohn, weil diese seit Jahren schon den größeren Teil davon bei dem Wirte sich hatte ansammeln lassen: er war ihre Sparkasse sozusagen! Schon daran erkennt man, daß die Geschichte vor langer Zeit sich ereignet haben muß, denn Mägde dieser Art gibt es nicht mehr heutigen Tages oder nur mehr ganz selten. Es war, es ungefähr zusagen, um das Jahr 1800, das ist eine schöne, runde Zahl, es kann aber auch ein Jahrzehnt früher gewesen sein oder später, das spielt hier keine Rolle. In der Gaststube also legte die Wirtin der Scheidenden das Geld auf den blanken Ahorntisch, in harten, klirrenden Stücken, ein stattliches Sümmchen und gab noch zwanzig Gulden dazu, weil sie immer so überaus zufrieden mit ihr gewesen war und schenkte ihr auch einen silbernen Rosenkranz.
Die Magd knotete das Geld und den Rosenkranz in ein Schnupftuch und tat das Schnupftuch in eine verborgene Tasche ihres Unterrocks und dann gingen die beiden Frauen auseinander, unter vielen Tränen und Umarmungen, und der Wirt, der herzugekommen war, hätte fast auch geweint und schnitt fürchterliche Gesichter, es nicht tun zu müssen.
Die Magd machte sich zu Fuß auf den Weg, schritt munter und unbeladen aus, denn ihre wenige Habe sollte ihres Bruders Knecht nächstens abholen. Es war ein wolkenlos blauer Tag im frühen Sommer und die Magd, ein hochgewachsenes Frauenzimmer mit einem schönen und zufriedenen Gesicht, freute sich, den Schmerz der Trennung still verwindend, schon auf ihr künftiges Daheim, und unter ihren Füßen wölkte der Staub, daran es in Ungarn nie gemangelt hat.
Nun war, es hatte weiter niemand seiner geachtet, ein Mann bei seinem Glas Wein in der Gaststube gesessen, in der hintersten Ecke, als die Lohnauszahlung stattgefunden hatte. Der war zu Pferde gekommen und ritt jetzt der Magd nach. Bei einem Birkenwäldchen holte er sie ein. Er hatte einen langen, hängenden Schnauzbart, wie ihn die Kroaten zu tragen lieben, und ohne viel Umstände zu machen, sagte er, sie solle ihr Geld herausgeben, und dazu lachte er frech. Sie war nicht gewohnt zu lügen, die Magd, es war Sünde, aber jetzt und hier schien ihr doch erlaubt, zu einer Notlüge Zuflucht zu nehmen, und also sagte sie, sie habe kein Geld. Der üble Kerl lachte nur wieder und sagte, sie solle keine Fisematenten machen und zerrte ganz widerwärtig an seinem Schnauzbart, als wolle er ihn sich ausreißen, und knirschte mit den Zähnen. Die unerschrockene Magd aber behielt Fassung und Besinnung und während der Wegelagerer damit beschäftigt war, sein von einem Bremsenstich unruhig gewordenes Pferd zu bändigen, warf sie schnell das Schnupftuch mit dem Geld und dem Rosenkranz, ungesehen von ihm, hinter sich in ein Gebüsch.
Der Räuber auf dem wieder stillen Pferde wurde jetzt arg böse und »Heraus mit dem Zaster!« schrie er, und sie solle sich ausziehen, schrie er, er werde das Geld schon zu finden wissen, wo sie es auch versteckt haben möge, im Leibchen oder unter den Röcken! Und gleich stieg er ab, schlang sich den Zügel um den Arm, und half der Magd auf seine Räuberweise beim Ausziehen, riß ihr die Kleider herunter und Mieder und Hemd und durchstöberte alles und fand nichts und hatte keinen Blick übrig für die nun ganz hüllenlos vor ihm Stehende, auf das Geld nur erpicht! Die Magd schämte sich sehr ihrer Blöße und ihres vollen, weißen Busens und ohne Gewand zu sein vor einem Mann, auch wenn er sie nicht ansah, schien ihr größere Sünde als gelogen zu haben. Der Gauner nun, als er nichts und garnichts fand, bedrohte sie mit einem grausamen Tode, wenn sie jetzt nicht endlich mit ihren Gulden herausrücke und klopfte sich auf die Brust, wo seine Jacke sich verdächtig bauschte, und sagte, hier habe er eine Pistole, und sie sei schon geladen, und es war ihm anzusehen, daß er stracks ernst machen würde.
Da sagte die Magd: »Dort hab ichs hingeworfen!« und zeigte auf das Gebüsch, und jetzt wurde der wüste Mensch wieder vergnügt und wies ihr seine prächtigweißen Zahnreihen unter dem Schnauzbart und sagte: »Halt derweil mein Pferd!« Er gab ihr die Zügel und kroch in das wilde Gebüsch hinein und seine Husarenstiefel sahen komisch daraus hervor und es blitzten die Sporen daran. Sie hörte ihn noch sagen: »Da ist es ja!« als sie sich, Bauerntochter die sie war und mit Pferden umzugehen gewohnt, schon in den Sattel geschwungen hatte, den Gaul mit den unbespornten Fersen mächtig antrieb und davon sprengte.
Das gab nun freilich viel Verwunderns, als eine Frau, nackt wie Eva vor dem Sündenfall, die Dorfstraße daherritt, am hellen Tage, und die Bauernweiber am Brunnen hielten mit dem Schöpfen inne und bekreuzigten sich vor der weißen Teufelin und die Bauernburschen blieben wie erstarrt stehen und rissen den Mund und die Augen auf vor dem Anblick, denn die Magd war schön, wie gesagt, und herrlich und lustvoll zu betrachten.
Vor dem Pfarrhaus neben der Kirche gelegen und gleich als solches zu erkennen, hielt die Reiterin und sprang aus dem Sattel und stürzte ins Haus und öffnete im Flur die nächstbeste Tür und hatte Glück, es war des Pfarrers Schlafstube, zu der sie führte, und riß das Leintuch vom Bett und hüllte sich darein. Dann rief sie laut ihres Bruders Namen. Der war gerade im Keller und hörte sie und kam herauf, wo er kühle Milch für sich geholt hatte. Sie erzählte ihm in der Geschwindigkeit das Notwendigste und er lobte ihren Mut und sagte aber auch: »Jetzt ist dein Lohn für viele Jahre dahin«, und bekam ein trauriges Gesicht. »Und der Rosenkranz auch!« antwortete die kluge Magd, »aber dafür haben wir das Pferd!« Wieder mußte der geweihte Herr sich wundern über die Umsicht seiner Schwester.
Inzwischen hatte der Pfarrknecht, unter groben Flüchen, die ihm nicht anstanden, weil er ja geistliches Brot aß, die Leute verjagt, die das zitternde Pferd umstanden, und hatte es in den Stall geführt, zu des Pfarrers einziger Kuh. Und dann ergab es sich, daß das Pferd von edler Rasse war und einen überaus kostbaren Sattel trug und fein gearbeitetes Riemen- und Zügelzeug. In den Satteltaschen fanden sich keinerlei Papiere, aber an die tausend Gulden Bargeld. »Das ist Sündengeld und es klebt vielleicht Blut daran«, sagte der Pfarrer, »und wir wollen es dem Herrn Stuhlrichter anzeigen.« Die Behörden nun nahmen sich der Sache an und machten Nachforschungen überall hin, und die Kanzleien arbeiteten fieberhaft und die Landpolizei, aber von einem Räuber war keine Spur zu finden, als hätte der Erdboden ihn verschluckt. Es ist anzunehmen, daß er außer Landes gegangen war, dort sich zu betätigen, und vielleicht ist er dort auch am Halse aufgehängt worden, wie ihm nur recht geschehen wäre. Er hatte sich benommen wie ein Hecht, der, einen großen Fisch im Maul, nach einem kleineren schnappt und den großen deswegen muß fahren lassen und dieser Dummheit wegen hätte er verdient, zweimal aufgehängt zu werden.
Erstaunlicherweise meldete sich niemand, der in der letzten Zeit beraubt worden und hätte Ansprüche gestellt. Vielleicht hatte der Kroat das Geld den eigenen Spießgesellen abgenommen, und die wollten nichts mit den Gerichten zu tun haben oder was sonst es eine Bewandtnis haben mochte mit dem Inhalt der Satteltaschen. Und also gab man der Magd von dem Räubergeld soviel als der ihr gestohlene Lohn betrug und sprach ihr überdies zweihundert Gulden zu, so, wie man ja auch einen Finderlohn bekommt, und auch das Pferd durfte sie behalten, so war es gesetzlich. Das beste Geschäft machte wie immer die Obrigkeit, die das Übrige beschlagnahmte, und das war das meiste, wie man leicht nachrechnen kann.
Von dem ihr zugesprochenen Gelde stiftete die Magd für die Dorfkirche eine brokatene Altardecke und zwei große silberne Kerzenleuchter und das fand den allgemeinen Beifall. Und so trug man es ihr auch nicht nach, daß sie ohne Gewand sich hatte im Dorf sehen lassen. Ein paar alte Weiber zwar meinten, die Schwester des Pfarrers hätte, der Würde ihres Bruders eingedenk, schon vor den ersten Häusern des Dorfes absteigen können und die Nacht erwarten, um sich unbemerkt heimzuschleichen, jedes Ärgernis vermeidend – aber nachträglich und in Sicherheit so zu reden ist billig! Und die Spottvögel unter den Bauern gar pfiffen sich eins und sagten abends im Wirtshaus, die spindeldürren Hexen allerdings hätten guten Grund, sich niemandem und niemals in dem Zustand, wie der Herr sie auf die Erde geschickt habe, zu zeigen, und sie spuckten kräftig aus und lachten.
Die Magd waltete ihres Amtes als Hausbesorgerin ihres geistlichen Bruders nicht lange. Einer der Burschen, ein wohlhabender Bauernsohn, der sie weiß und glänzend hoch zu Roß gesehen hatte, und ihm schwebte das Bild seitdem bei Tag und Nacht vor, hielt um ihre Hand an, und sie gab sie ihm.
Und nur ihm auch sagte sie: Neulich beim Einschlafen sei ihr zu spät der Gedanke gekommen, daß sie dem Räuberkerl ja gar nicht das richtige Gebüsch hätte zu zeigen brauchen, sondern irgend ein anderes, in dem nichts zu finden gewesen wäre – so arg gescheit, wie man das jetzt überall von ihr erzähle, sei sie eben doch nicht – und sie gab ihm einen Kuß! Aber auch ihm nicht sagte sie, die kluge Magd, daß sie sich zuweilen eines sündhaften Ärgers nicht ganz erwehren könne darüber, daß der Kroat ihr Unbekleidetsein so gar nicht beachtet habe, und daß sie willens sei, das nächstens zu beichten, aber nicht ihrem Bruder, sondern dem Pfarrer des Nachbardorfes. So war ihre schöne Beschaffenheit.
Bei der Hochzeit durfte natürlich die Ochsenwirtin nicht fehlen und nicht ihr Mann. Schwelgerisch ging es dabei her, mit Paprikagulasch und gebratenen Ferkeln und vielem roten Wein und die Ochsenwirtin schenkte der Neuvermählten ein himmelblaues Seidenkleid und auch einen neuen silbernen Rosenkranz.
So endet diese Geschichte, die in einem Wirtshaus begann, nun doch nicht in einem Pfarrhaus: sie endet in einem Bauernhaus, mit einem strohernen Dach darauf und einem Ziehbrunnen vor dem Pferdestall, und die schöne Bäuerin gebar ihrem Mann fünf Kinder im Laufe der Jahre, und nie prügelte er sie, auch an den Festtagen nicht, wenn er betrunken war, wie es die anderen Bauern mit ihren Weibern machten: sie war des Pfarrers Schwester, aber das nicht allein hielt ihn davon ab!
Ambros
Ambros war Holzfäller, und während des Sommers kam er nur selten hinunter ins Tal und ins Dorf. Jeden zweiten oder dritten Sonntag vielleicht, mochte der Pfarrer auch schimpfen über den messeversäumenden Heiden. Die Hütte lag eine Stunde über dem Dorf, und der Weg zu ihr, der durch dicke, feuchte Wälder lief, war steil und voll Geröll. In der Hütte schlief Ambros mit noch zwei Kameraden. Nach der Arbeit kochten sie sich selber das Essen, Mehlschmarren zumeist, mit viel Fett und tranken mitunter ein Glas Enzianschnaps. Aber das war das Seltenere. Auf dem Laublager schnarchten sie, dröhnend wie ein Holzerfuhrwerk.
An einem Sonntag saß Ambros auf der Bank vor der Hütte. Er hatte sich den Wochenbart wegrasiert, die bessere Joppe angezogen, lehnte den Kopf gegen die warme Holzwand, die kochte wie ein Suppentopf. Ihm gegenüber stieg das Kuhhorn in das heiße Blau des Nachmittags. Der graue Stein glänzte und die Wälder sahen aus wie Schorf. Es war zwei Uhr und um vier Uhr erwartete ihn Maria unten am Kreuzeck. Das war eine Waldwiese, eine kleine halbe Stunde über dem Dorf. Ambros verschloß sorgfältig die Hüttentür und rüttelte an Schloß und Riegel. Den Revolver hatte er in der Tasche. Es war eine lumpige Zeit, immer wieder hörte man von Hütteneinbrüchen. Er war im Krieg gewesen, wußte mit Waffen umzugehen, und den Revolver hatte er sich aus dem Feld mitgebracht. Er schoß nicht schlecht, er schoß sogar gut. Aber die Munition war zu teuer, so knallte er nur hier und da nach einem Eichhörnchen, nur hier und da nach einem Raben.
Er stieg bergab. Der Wald nahm ihn auf, es wurde kalt wie im Keller, das Grün umschauerte ihn, ein Häherruf scholl. Löste sich ein Stein unter seinen genagelten Stiefeln und kollerte vor ihm, dachte er: Spräng er einem Reh an den Kopf, leicht wärs tot! Der Wald wurde lichter, gleich kam das Kreuzeck. Das war der Platz, wo die Bauernmädchen mit den Burschen sich trafen. Es war nicht weit herauf vom Dorf, weit genug, daß die Alten die Mühe scheuten. Manches Paar wäre an schönen Sommertagen aus dem heißen Gras aufzuscheuchen gewesen. Maria war noch nicht da. Sie kam schon noch. Er war zu früh daran. Er sah ein paar Erdbeeren rot aus dem Grün funkeln. Er aß, ging den roten Kugeln nach, es wuchsen mehr. Er hörte Stimmen, lugte um einen Strauch, und sah nichts als vier Füße. Zwei steckten in festen, genagelten Männerschuhen, zwei in neuen, hochschäftigen Damenstiefeln, wie sie selten ein Bauernmädchen trägt. Die Mädchenstiefel sollte Ambros kennen. Er hatte sie in der Stadt gekauft und seiner Braut geschenkt. Ambros vernahm, wie die beiden Küsse tauschten, und es überlief ihn eiskalt. Gebückt wie er war, blieb er stehen, rührte sich nicht, sah den Ansatz der Strümpfe, das runde Bein, und das Girren klang ihm ins Ohr. Er zog seinen Revolver. Die Mündung suchte nach dem Platz, wo die Köpfe des Paares liegen mußten, schwankte, schwankte irr. Dann senkte Ambros den Lauf, er zielte, zielte gut auf die rotbestrümpfte Mädchenwade, zauderte nicht mehr und Schoß. Eine Stimme kreischte, es rauschte im Gebüsch, und wie ein Narr floh Ambros in den Wald. Niemand verfolgte ihn. Der hatte genug zu tun, die verwundete Magd ins Dorf zu schaffen. Ambros Schoß noch ein paarmal, blindlings, auf die Bäume, bis er keinen Schuß mehr in der Waffe hatte. Dieses Frauenzimmer! Ihr Leben lang sollte sie auf Krücken laufen! Und wenn sie runzlig und verdorrt als altes Bettelweib durchs Dorf humpelte, sollten ihr Kinder die Krücke stehlen, daß sie greinend im Straßengraben zappelte, wie ein Frosch, dem man ein Bein ausgerissen hat! Dieses Frauenzimmer! Ließ sich vom Nebenbuhler zum Stelldichein begleiten und kürzte sich die Zeit des Wartens mit Verrat.
Im Bogen stieg Ambros zur Hütte empor. Er reinigte den Revolver, lud ihn von neuem. Er war allein, die beiden Kameraden schon seit dem frühen Morgen im Dorf. Wer sollte wissen, daß er der Täter war? Dieses Frauenzimmer, sagte er wieder. Er klopfte mit der Faust auf die Bank, schnell; immer schneller, einen Wirbel, pfiff dazu, grell, immer greller, und Pfiff und Wirbel dröhnten in seinen Ohren zusammen höllisch wie Trommelfeuer, und nun fielen ihm ein paar Tränen aus den Augen. Er hörte jemand rufen, hörte deutlich seinen Namen Ambros. Kam man schon? Aber es war Maria. Er starrte sie an. War es ihr Gespenst? Aber es war Maria, erhitzt vom Steigen. Er sah auf ihre Füße. Sie trug ihre Arbeitsschuhe. Warum bist du nicht gekommen? fragte sie vorwurfsvoll. Da hockst du auf der Bank und ich warte auf dich. Sie stampfte mit dem Fuß auf, in dem doch eine Kugel sitzen mußte, stampfte auf und fragte: Warum bist du nicht gekommen? Sie küßte ihn, drückte ihn an sich: Lieber Ambros! Er sah nur immer auf ihre Füße. Sie errötete. Ich muß es dir erzählen. Die schönen Stiefel, die du mir geschenkt hast! Sei nicht bös.
Wo sind die Stiefel? fragte er. Anna bat mich so drum. Sie wollte sich mit einem Burschen treffen, zum erstenmal, und wollte ihm gefallen, und bat mich, ihr die Stiefel zu leihen. Nur dieses eine Mal. Und sie wollte sehr achtgeben darauf. Nun liegt sie drunten und der Stiefel hat zwei große Löcher im Schaft. Zum Glück ging der Schuß nur durchs Fleisch. Ambros hielt den Atem an. Er legte den Arm um Maria, fühlte ihre volle Brust, drückte den Kopf gegen ihre Schulter, nun sah sie sein Gesicht nicht, und er fragte: Schüsse? Ist auf sie geschossen worden? Von weit her hörte er: Man trug sie an mir vorbei, als ich zu dir ging. Der junge Doktor, der Sommerfrischler, sagte, es sei gut ausgegangen. Der Knochen sei nicht getroffen. Maria sagte noch leise: Und das mit meinen schönen Stiefeln an den Füßen! Ambros fragte: Man weiß nicht, wer geschossen hat, und warum? Sie antwortete: Es treibt sich jetzt viel Gesindel herum. Der Gendarm wirds schon herausbringen. Meinst du? murmelte Ambros. Aber die Stiefel schenkst du der Anna. Ich will dir ein Paar neue kaufen. Bis der Herbst kommt, hab ich mir so viel erspart. Es war dämmerig geworden und Ambros begleitete Maria noch ein Stück des Heimwegs.
Als er wieder aufwärts stieg, saß die Freude in seiner Brust so schwer, daß er oft stehen blieb, an einen Baum gelehnt, um tiefer zu atmen. Es saß die Freude in seiner Brust so schwer; daß es ihm fast die Rippen sprengte. Er war wie der heilige Christophorus, der das Knäblein trug, das schwer wurde wie ein Klumpen Gold und noch schwerer. Wie der Heilige schleppte er keuchend sein Glück durch den Mondwald, und als er vor seiner Holzhütte stand, war es, daß er das Beil nehmen mußte, das unter der Bank lag, und es im Mond mußte spiegeln lassen. Drunten im Dorf lag die Anna, das Bein zerschossen, und ihn zermalmte fast das Glück. Er konnte nicht traurig sein. Ein Lachen gluckste und gluckerte in seinem Hals, er schluckte es schnell hinunter, bei dem Gedanken, daß er traurig sein sollte, weil die Anna unten, die wildfremde Person, ein zerschossenes Bein in Binden hatte. Aber, o ja, Blut um Blut, Aug um Aug, Zahn um Zahn, er trällerte es wie ein Lied, vergnügt wie ein junger Star, aber, o ja, er konnte sich den kleinen Finger abhacken. Oder nicht den ganzen kleinen Finger, so vorn nur die Kappe, daß der Anna genug geschehe, denn mit dem schweren Glück, das er trug, geschah ihr nicht genug. Er nahm das blinkende Beil, legte die linke Hand auf die Bank, aber da brach das verschluckte Lachen zutiefst aus ihm heraus. Lachend warf er das Beil fort, lachend kroch er auf seine Pritsche, und als seine beiden Schlafkameraden bald darauf eintraten, sahen sie im Mondlicht Ambros liegen, der mit beiden Fäusten das Glück von seiner Brust wegstemmte, hochstemmte,, das ihn fast erdrücken wollte.
Am andern Morgen, sie hatten schon zwei bis drei Arbeitsstunden hinter sich, blinzelten in einer Pause träg und genießerisch in die Sonne, die auf dem Wipfel einer hohen Föhre schaukelte, am andern Morgen gegen acht Uhr früh war es, daß Michael, des Ambros Kamerad, ansetzte zu einer Erzählung, die ihn bedrückte, um die er sich erleichtern mußte. Und er erzählte auch, während der dritte fünfzig Meter tiefer schallend werkte, er erzählte etwas, was Ambros nicht fremd war. Stockend erzählte er, fluchte dazwischen, und hoffte, daß Ambros ein Einsehen hätte und das Nichtzuerklärende, das Sonderbare des gestrigen Sonntagnachmittags ihm aufhellen werde. Davon wußte Michael nichts, daß das Mädchen, das in seinen Armen erdbeerumblüht gelegen war, die Stiefel an den rotbestrümpften Beinen trug, die Ambros in der Stadt gekauft hatte. Damit hatte doch das lüsterne Ding als mit ihren eigenen geprahlt. Fluchend sagte er und mit einem Lachen voll Scham: Ich lag bei Arras in Feuerüberfällen, aber so überraschend ist mir noch kein Schuß gekommen, als der gestern. Er hätte uns beide auf einmal totschießen können, mit einem Schuß. Er erblaßte. In diesem Augenblick, sagte er, bedenk, in diesem Augenblick, da erwartet man keinen Schuß. Der Strolch, Hasen gibts und Rehböcke, darauf zu schießen, aber ein Liebespaar in den Erdbeeren! Ambros gab zu bedenken: Ein Närrischer vielleicht. Närrisch oder nicht, schrie Michael verstört, und schlug mit der Axt auf den Stamm los, von dem sie die Rinde lösten. So möchte ich ihn daliegen haben, so schlüg ich drauf! Er schlug so mächtig zu, daß ein handgroßes Stück lossprang, kerzengerade Ambros an die Stirn, so scharf, daß es ihm eine Wunde riß und Blut floß. Immer trifft man den Falschen, sagte Michael, als sich Ambros das Blut abwischte, und sah wild um sich, als suche er den Richtigen. Ambros band sich das Taschentuch um die Stirn und war froh, daß er sich gestern nicht die Kleinfingerkappe abgehackt hatte, und lachte, weil ihm Blut von der Stirn träufelte, und fühlte es als einen Ausgleich, und fand sich nun ganz und gar von Schuld gereinigt, und weil nun die Sonne wieder höher gestiegen war und der Tag vorrückte, schlugen sie schallend auf den Stamm los, der zur Hälfte rindenlos und blank im Licht glänzte.
Das Erbbegräbnis am Lech
Ein schöner Tag wars und sommerlich heiß. Blau und seidig war der Himmel, hoch stieg vor ihnen der Berg hinan, andere daneben. Die beiden waren gern und nicht zum erstenmal auf der Landzunge, die sich in den Lech hineinschob, eine Insel fast wars, voll Gestrüpp. Die Brennesseln eiferten, das ganze Stück Land sich untertan zu machen, halb gehörte es ihnen schon. Die andere Hälfte gehörte den gelben Königskerzen. Der Fluß rauschte wild vorbei, über Steinblöcke schäumend. Sie hatten einen schönen Blick in das Tal hinein, grün, grün war es, von fern blitzte wie Gold das Kreuz der Dorfkirche. Im Wirtshaus daneben wohnten sie zur Sommerfrische. Und das Wasser sang, sang, und Forellen waren im Lech – hin und wieder sprang eine. Herrlich war die Einsamkeit hier, ein verwildertes Paradies.
Die Frau hatte einen Zeichenblock auf den Knien, sie saß auf einem Klappstuhl und zeichnete. »Königskerze und Brennessel«, sagte sie, »soll das Blatt heißen.« Steil und königlich stand die Kerze, die Brennessel brannte: auf dem Blatt war es noch einmal zu sehen. »Ach«, sagte die Frau, »für immer möcht ich hier bleiben!« Sie war nicht groß, nicht klein, mager, mit einer scharfen Vogelnase, und trug ein weißes Leinenkleid, und ein Strohhut beschattete ihr Gesicht. Der neben ihr, der Junge, hochaufgeschossen, war in der Badehose, und man sah seine mageren Rippen. Das Vogelgesicht hatte er von der Mutter, der Dreizehnjährige. Sein Vater, ach, der Vater – die Eltern lebten getrennt, wo mochte der Vater jetzt sein? Der Junge sah ihn nur zu kurzem Besuch, hie und da einmal. Dann gingen die Eltern seltsam miteinander um, sehr höflich, voll Behutsamkeit, als könnte manches wehtun. Der Junge hing an seinem Vater und mußte merken, daß der immer gern wieder ging, kaum, daß er gekommen war.
Er dachte jetzt an ihn, ihn herbei wünschend. Die Frau nicht. Sie sah nur die Königskerze. Der Vater hatte den Urlaub bezahlt, wußte der Junge, und schickte auch sonst Geld. Bekümmert sah er die Mutter an. Wer versteht die Großen? Er schnitt sich mit dem Taschenmesser ein Stöckchen von einer verkümmerten Weide. Zeichnen ist ihr das liebste, dachte er, daheim in der Werkstatt, in der sie auch wohnten, mit seinem Schlafkämmerlein daneben, hingen viele Blätter, ungerahmt, mit Reißnägeln an den Wänden befestigt. Sie zeigten auch nackte Menschen. Er zog seine Badehose höher. Ach, die Mutter – über dem Zeichnen vergaß sie alles! Alles sieht sie scharf an, dachte er, aber die Unordnung daheim sieht sie nicht. Wenn er dann aufzuräumen begann, lachte sie nur. Sie ist eben großzügig, dachte er entschuldigend. Er liebte seine Mutter. Sie erzog ihn nicht, aber er versuchte, sie ein wenig zu erziehen. Eine schwarze Hummel sauste gegen seine Brust und entfernte sich ärgerlich. Die Brennesseln brannten in grünem Feuer. Die Mutter war fertig mit der Zeichnung und hielt ihm das Blatt hin und er sagte gehorsam: Schön! Sie sagte: »Verstehst du denn was davon?« O, er hatte schon einen Blick dafür, was schön war! Aber er wollte es nicht zeigen, und wollte nicht zeigen, daß er seine Mutter bewunderte. Ihr nicht. Gegen andere rühmte er sie.
Sie nahm den Strohhut ab und legte ihn ins Gras und sich daneben und sah zum Himmel auf. »Dein Kleid wird Grasflecken bekommen«, sagte er. »Sei nicht fad und schimpf nicht«, sagte sie, »nach getaner Arbeit ist gut ruhn.« Alles ringsum dampfte Kraft und Lebenslust und drängende Fülle – er sah es auch, und empfand es auch, aber er wollte es nicht zugeben. Er hatte auf einmal Sehnsucht nach der sauberen Wirtsstube, drunten, im Dorf, mit den weiß gescheuerten Tischen. Und da sagte die Mutter und räkelte sich: »Herrlich ist die Wildnis hier! Ach«, sagte sie, »hier möcht ich begraben sein! Was meinst du«, sagte sie, »Karl, wir kaufen das Stück Land, es kann nicht teuer sein, und errichten uns ein Erbbegräbnis.« Geradezu sehnsüchtig klang es. Da stiegen Tränen in seine Augen. Er sah die unaufgeräumte Werkstatt vor sich, und das Mittagessen kam zu spät auf den Tisch, und der Vater war so selten da, und seine Stimme zitterte, als er sagte: »Nein, nein, Mutter!« Er schlug mit seinem Stöckchen in die Brennesseln, daß die grünen Funken stoben und sagte: »Ich möchte auf einem richtigen Friedhof begraben sein, wie andere Leute auch!« Er dachte an einen Dorffriedhof, wo sie gestern gewesen waren, Grabstein neben Grabstein, in schnurgeraden Reihen, mit genauen Inschriften, Geburtstag und Todestag, und Blumen davor, und abends läutete die Glocke der Friedhofskapelle. Er sagte: »Ich möchte ein ordentliches Grab haben, wenn ich schon einst sterben muß!« Er sagte es mit dem Ton, als glaube er nicht recht daran, daß auch er sterben müsse. Die weißgekleidete Frau lachte und sagte: »Gib mir einen Kuß!« und er küßte sie und fühlte, daß er sie sehr liebe, und sie ihn auch.
Schule der Höflichkeit
In der großen und volkreichen Stadt London gibt es viele enge Gassen; die gabs dort schon vor zweihundert und mehr Jahren, und sie sind nicht breiter geworden seitdem – beharrend ist das englische Wesen. Die Herren trugen weißgepuderte Zöpfe damals und Schnallenschuhe, und die Damen ließen die Schuhe nicht sehen, so züchtig lang waren die Röcke, aber dafür geizten sie mit dem Stoff um Hals und Brust.
Zwei Ladies, wie man dort die Frauen höherer Stände nennt, waren unterwegs zu einer Putzmacherin, die einen großen Namen hatte, aber ihr Geschäft in einer dunklen, schmalen Gasse: das soll des Landes so der Brauch sein, hört man, und man vermeidet es, protzig nach außen hin zu tun. Die Ladies saßen in einem hochrädrigen Wagen, vor den zwei Pferde gespannt waren, und steif wie ein Ladestock saß auf dem Bock der Kutscher. Die Damen schwätzten ein bißchen miteinander, dies und das, und als der Wagen vor dem Putzgeschäft hielt, stieg die eine aus und sagte zur andern: »Warte ein wenig, und gleich bin ich wieder da!« Die Freundin blieb wahrhaftig sitzen, was merkwürdig ist, denn gern begleitet eine Frau die andre zu einem Einkauf, aber sie hatte Kopfweh vielleicht oder am Morgen einen Brief bekommen, über den sie nachsinnen mußte, und antwortete also nur: »Beeile dich, meine Beste!« Die rauschte hinweg.
Die Kutsche nahm einen ziemlichen Platz ein, und doppelt groß und ungetümlich wirkte sie in der engen Gasse, und so war es nur gut, daß keine andre ihr entgegen kam: an ein Ausweichen wäre nicht zu denken gewesen! Und wer von den Fußgängern an dieser Stelle die Gasse überqueren wollte, weil er jenseits zu tun hatte, oder das Kaffeehaus ihn lockte, das drüben war, der mußte einen umständlichen Bogen um das Gefährt machen. Manche taten es auch. Ein Herr jedoch, der hinüber wollte, blieb ärgerlich stehen und rief dem Mann auf dem Bock zu, er möge weiterfahren. Aber der sah und hörte nichts, versteht sich, und machte sein hochmütigstes Kutschergesicht. Der eilige Herr indessen war einer von den Kurzentschlossenen. Er riß den Wagenschlag auf, stieg in den Wagen, und sagte: »Um Vergebung«, und lüftete den Hut vor der Dame, und öffnete die jenseitige Türe und stieg aus, und drüben war er, auf dem kürzesten Weg. Noch verwirrt und unbegreifend sah die Lady ihm nach, als schon ein andrer Herr, der alles mitangesehen hatte, auch durch den Wagen ging, um Verzeihung bittend auch er, und den Hut höflich hebend, und er brauchte nicht einmal die Wagentüren zu öffnen, sie standen ja noch sperrangelweit offen!
Was sich nun ereignete, geschah wie auf Verabredung. Ein dritter Herr nahm den Wagenpfad, als sei es das natürlichste von der Welt, und andre folgten so schnell, daß keine Lücke entstand im Zug der an der Dame vorüber Wandelnden, und es war anzusehen, als liefen Ameisen über einen Stein, der ihnen den Weg sperrte. Und jeder der Eiligen hielt sich an die Vorschriften der Höflichkeit und erbat sich Verzeihung, und grüßte ehrerbietig, ob ihm auch ein Lachen den Hals kitzeln mochte. Die Lady fühlte eine Ohnmacht nahen, und daß ihr die Augen naß werden wollten, und sie hob den Seidenrock ein wenig, daß ihr niemand drauf trete, und dachte des Briefes, der ihr heut am Morgen solchen Kummer gemacht hatte und nun dies! Sofort nach Haus zu fahren, rief sie mit erstickter Stimme dem Mann auf dem Bock zu, der die ganze Zeit gesessen hatte, als ginge ihn nichts an, was hinter seinem Rücken geschah: nach vorn zu schauen war seine Kutscherpflicht! Jetzt knallte er mit der Peitsche und die Pferde zogen an.
Als nach einer reichlichen Stunde eine junge Dame, noch glühend von der Lust des Wählens und Verwerfens, aus dem Putzmacherladen trat, fand sie weder ihre Freundin vor, noch Wagen und Pferde und Kutscher, und wahrscheinlich ist sie zu Fuß nach Haus gegangen, oder sie nahm einen Mietwagen.

Schule der Höflichkeit. Zeichnung von Pec Rice.
Das Goldstück
Den Vierzehnjährigen hatte es nicht länger mehr zu Hause gelitten. Dieses Zuhause war eine Hafenschenke in Marseille, die sein Vater bewirtschaftete. Die Mutter kochte für die Gäste und hielt die drei Schlafkammern im ersten Stock sauber, ohne darin zu übertreiben. Es war nicht gerade das vornehmste Volk, das hier zu nächtigen pflegte, Matrosen und kleine Händler, wohl auch einmal ein augenrollender Neger aus Tunis. Der rote Provencer Wein, den es gab, war gut und stark und billig, und die Fischsuppe, mit Safran und Pfeffer gewaltig gewürzt, schärfte die Lust nach ihm. Messerstechereien, nun die ereigneten sich, es wurde aber nicht viel Aufhebens gemacht davon oder gar die Obrigkeit bemüht, die hielt man sich lieber vom Halse. Die Eltern, die sich nicht mehr und nicht weniger als üblich um ihren Pierre gekümmert hatten, waren nicht untröstlich, als der eines Tages verschwunden war, zur See gegangen, die vor seiner Nase lag und lockte; und die Erzählungen der Matrosen mochten ein übriges getan haben. Auf einem Zettel hatte der Ausreißer einen kurzen Abschiedsgruß hinterlassen, weil er schreiben konnte, und nicht jeder konnte das damals, um das Jahr 176o. »Daß dich . . .« hatte der Vater Renard geflucht, als er den Wisch seiner ungelehrten Frau vorlas – und weg war das Söhnchen!
Pierre ward Schiffsjunge und Leicht- und Vollmatrose, er ließ sich den Wind um die Ohren blasen und fuhr um die halbe und dreiviertel Welt. Dann blieb er in dem Lande Indien, als Soldat zuerst und später als Handelsangestellter. Er sah Affen und Elefanten, Götzentempel und nackte Heiden und gepanzerte Krokodiltiere in den Flüssen. Nach zwanzig Jahren, es ist leicht nachzurechnen, war er vierunddreißig geworden, ein viel erprobter Mann mit einem schwarzen Knebelbart, und hatte drei Lederbeutel voll von Goldstücken in seiner alten Seemannskiste. Das war sein Erspartes, er war geschickt und beflissen gewesen in den Geschäften, und Glück hatte er auch gehabt, das gehört dazu.
Und dann, so ist das oft, stieg immer leuchtender das Bild der Heimat vor ihm auf. Er sah, im Schlafen und im Wachen, die Gassen Marseilles vor sich und roch ihren Geruch, der anders ist als jeder andere. Das fremde Essen, Reis und Vogelbrüste und Bambus, wollte ihm nicht mehr schmecken, und seine eingeborene Frau, klein und zwitschernd, von einem Götzenpriester ihm angetraut, mochte er nicht mehr anschauen – kurz, das Heimweh plagte ihn über die Maßen. Er löste die Verbindung mit seinem Handelshause, und dem Weibe schenkte er ein halbes Dutzend von den Goldstücken – damit mochte sie leicht einen neuen Mann gewinnen! Und lockend lag wieder das Meer vor seiner Nase, weiß schimmernd, und Schiffe fuhren darauf, mit geblähten Segeln, und eines fuhr nach Frankreich, fuhr nach Marseille, und er bestieg es, und das viele Gold nahm er mit – es klirrten die Beutel!
Gleich nach der Ankunft in seiner Vaterstadt ging er, nur mit einem Felleisen in der Hand, zu seinem Taufpaten. Die Seemannskiste hatte er gegen Schein und gehörige Quittung einem Lagerhause zur Verwahrung gegeben. Er ging durch die Straßen und über die Plätze, und alle Leute redeten französisch, das klang ihm wie Nachtigallenschlag. Er traf den Paten auch an, der ein Gewürzkrämer war, und der erkannte ihn nicht wieder, fiel ihm aber um den Hals, als er seinen Namen nannte. Die Eltern lebten noch, Gott sei Dank!, und seien so weit gesund und wohlauf. Als ihm Pierre seinen Plan entwickelte, als ein Fremder und irgend ein Gast zu ihnen zu gehen, wie er sich das oft ausgemalt habe in schlaflosen Nächten, verwunderte sich der Pate. Warum denn die Heimlichtuerei? fragte er. Doch, beharrte der Heimkehrer, und es werde eine ungemeine Lust für ihn sein, still die unwissenden Eltern anzuschauen und eine schöne, friedsame Nacht im Vaterhause zu verbringen, in einer der Schlafkammern, und erst am Morgen darauf zu ihnen zu sagen: Seht euer Kind! Und er faßte sich an den Knebelbart und lachte sich eins in der Vorfreude.
Es seien schlechte Zeiten jetzt, meinte der Pate, und Pierre werde es merken müssen, daß es auch mit der väterlichen Schenke bergab gegangen sei und die Eltern Sorgen hätten und Schulden; so daß sie oft nicht wüßten, wo ihnen der Kopf stehe. Aber da rüttelte Pierre an seinem Felleisen und gab zu verstehen, daß er da vielleicht ein wenig helfen könne, und auch dem Paten habe er etwas zugedacht, aber das später! – und liebevoll packten sie einander bei der Schulter.
Eine Moritat – weiß man heute noch, was das ist? Auf den Jahrmärkten staunte das Volk sie an und gruselte sich: die aufgerollte Leinwand, auf der in heftig bunten Farben, Bild neben Bild, der Ablauf gräßlicher Untat dargestellt war und das Schlußbild gewöhnlich Galgen und Rad zeigte, daran der Bösewicht, von schwarzen Rabenvögeln umflattert, jämmerlich enden gemußt: denn es gibt eine Gerechtigkeit! Ein Ausrufer und Bänkelsänger, mit einem langen Zeigestab in der Hand, sprach deutend die Erläuterungen dazu, in schön gereimten Versen, singend mehr als sprechend, und eine Drehorgel machte die Musik. Erschüttert und recht zum Guten entschlossen, wandten sich die Zuhörer zur nächsten Bude, wo auf glühendem Eisenrost die Bratwürste zischten und knallten, und wie schmeckten die jetzt! Aber gehört das hierher und zur Geschichte des Indienfahrers? Es wird sich erweisen! – Der Indienfahrer also saß in der Wirtsstube des Hauses, in dem er geboren und aufgewachsen, und kannte jeden Tisch und jegliches Gestühl wieder, saß bei rotem Provencer Wein und scharf gewürzter Fischsuppe, auch Krebse und Muscheln waren darin, und betrachtete verstohlen die Eltern. Die Mutter war grausträhnig geworden, mit vielen Runzeln im Gesicht und gebückter, als ihren Jahren zustand; aber der Vater hatte sich wenig verändert und hatte noch den stechenden Blick, vor dem Pierre als Kind oft gezittert: ein Mann war er jetzt und zitterte nicht! Und keine heimlich raunende Stimme flüsterte dem Wirt zu, wer der fremde Gast sei, und auch das Mutterauge erkannte ihn nicht, den Knebelbärtigen, und es war ihnen nicht zu verdenken, bartlos war er und knabenhaft, wenn sie, selten genug, seiner sich erinnerten. Er hatte schon die Kammer besichtigt, in der er nächtigen würde, und trank jetzt seinen Wein, und nicht wenig, darob ihm sehr wohl wurde und warm ums Herz. Es waren nicht viele Gäste in der Wirtsstube, abgerissene Gesellen. Aber es waren seine Landsleute, und so gefielen sie ihm, sogar der Mann am Nebentisch mit der abgeschnittenen Nase, das sah abscheulich aus! Pierre trank ihm zu, und der tat ihm gemessen Bescheid, in königlicher Haltung.
Als der Knebelbart dann seine Zeche bezahlte, mit einem Goldstück und sich nicht herausgeben ließ, mit einer großartigen Handbewegung abwehrend, wurde das Gesicht des Wirtes weiß. Und der Wirt, der sein Vater war, leuchtete ihm mit einer Kerze zur Kammer hinauf, stellte ihm die Kerze hin und noch einen Schlaftrunk dazu, wie das die Sitte verlangte, wünschte ihm eine geruhsame Nacht und ging. Pierre hörte, wie er zwei Stufen auf einmal nahm, beim Hinabsteigen, so eilig hatte ers.
Die erste Nacht im Vaterhaus! dachte der Heimkehrer, tief und glücklich atmend, und dehnte die Brust. Das Felleisen steckte er unters Kopfkissen. In einem Zuge trank er den Schlaftrunk aus und streckte sich auf dem Bett aus und spürte nicht, wie hart es war. Er blies die Kerze aus, und im Dunkeln sah er wieder den Vater vor sich, wie sein Gesicht weiß geworden war beim Anblick des Goldstückes, und im Einschlafen noch dachte er mitleidig: Ihm kann geholfen werden!
Der half sich selber. Auf der Folter später gestand er die Tat, und daß er dem Schlaftrunk einen Saft beigemischt habe, auf daß der reiche Mann aus Indienland desto tiefer in den Schlummer sinke. Und so hörte der es nicht, als die Tür mit einem Nachschlüssel geöffnet wurde, und jemand leise an sein Bett trat. Und es war nicht der Mann mit der abgeschnittenen Nase, dem man es vielleicht hätte zutrauen mögen: es war der schlimme Wirt, mit einer Blendlaterne in der linken Hand. Pierre, vom Lichtschein getroffen, drehte sich träumend auf den Rücken, mohnbetäubt, dem Vater die Brust bietend für einen Stich ins Herz, und mit einem Seufzer verschied er. Daß es sein eigen Fleisch und Blut war, das er vom Leben zum Tode brachte – in den frühen und unwissenden Zeiten wäre das dem Unhold als straferschwerend angerechnet worden. Damals, in der Hafenstadt Marseille, die Aufklärung warf ihr Licht voraus, war man schon gerechter. Denn wäre er des Zusammenhangs inne gewesen, sagte sich das Gericht, hätte der Wirt Renard (das heißt Fuchs, aber hier erwies er sich als ein rechter Wolf) nicht zugebissen mit dem Messer. Die Gerichtsherren, alle Umstände bedenkend, nahmen es als einen gewöhnlichen und alltäglichen Mord, und dafür schien ihnen der Galgen die genügende Sühne. Den Täter aufs Rad zu flechten oder gar vierteilen zu lassen, davon nahmen sie Abstand. Die Mutter kam mit zehn Jahren schweren Kerkers davon, mit einem Hungertag einmal in der Woche.
Nur die Moritat, die dann vorgeführt wurde auf den Jahrmärkten in Arles und Narbonne und vielen Zulauf hatte, war noch ganz in den alten Vorstellungen befangen und strich es recht und schaurig heraus, daß der Sohn unter des Vaters Messer hatte verbluten müssen, und den Leuten einfältigen Gemütes lief es eiskalt über den Rücken bei des Bänkelsängers Lied. Der sang und vergaß zu singen von dem viel vermögenden Golde, aus dem man des Kaisers Krone macht und die Zepter der Könige und sang nicht von den dicken, gelben Goldmünzen und ihrer verführenden Gewalt, für die alles käuflich ist auf dieser Erde oder das meiste!
Der Wirt Renard denn also, den Bericht zu endigen, der Mann mit dem stechenden Blick, der auch mit dem Messer zu stechen verstand, und gut, sehr gut sogar, hatte seine schlafende Frau geweckt, daß sie ihm helfe, den Toten im Keller einstweilen zu verstecken, zwischen den Rotweinfässern, und ihn bei guter Gelegenheit nächstens und nächtens ins Meer zu werfen. Die entsetzte sich zuerst nicht wenig und schlug jammernd das Kreuz, und ein Grauen kam ihr an vor ihrem Eheherrn und Bettgenossen, der solches vermocht hatte; nie hätte sie es ihm zugetraut: einen Diebstahl schon oder schiefen Handel, aber dies! Sie schleppten den Sohn in den Weinkeller, zu dem nur der Wirt den Schlüssel hatte, und dann saßen sie zusammen und zählten die Goldstücke, und ihre Schuldenlast drückte sie nicht mehr, sie konnten sich wieder rühren und waren der Zuversicht, daß sich niemand um das Verschwinden eines knebelbärtigen Mannes kümmern werde, der schnurstracks aus Indien gekommen war – er hatte es sorglosverwegen selbst erzählt. Und wer weiß, wie er das viele Geld erworben hatte, mit Sklavenhandel vielleicht oder sonst dunklem Tun, so sagten sie einander, leise sich tröstend.
Aber da war der Pate, der am Morgen kam und fragte. Zu spät dämmerte es und fürchterlich dem wölfischen Paar. Und die Wölfin heulte wild und unmenschlich, als die Büttel sie beide holten. Nie vorher, und Daumenschrauben und Streckeisen hätten es ihnen peinlich abgenötigt, hatten sie einer Bluttat sich schuldig gemacht. Das Goldstück war es gewesen!
Galgen und Kerker taten gleichgültig das Ihre. Lieblich riechen die Gassen Marseilles für den, der es von Kind auf gewohnt ist. Und ein indisches Weib, bananenfarbig und zwitschernd, gebar ihrem zweiten Manne, einem Händler mit Töpferwaren und von niederer Kaste, einen Sohn – der erste, der weißhäutige, hatte ihr nicht dazu verhelfen können.
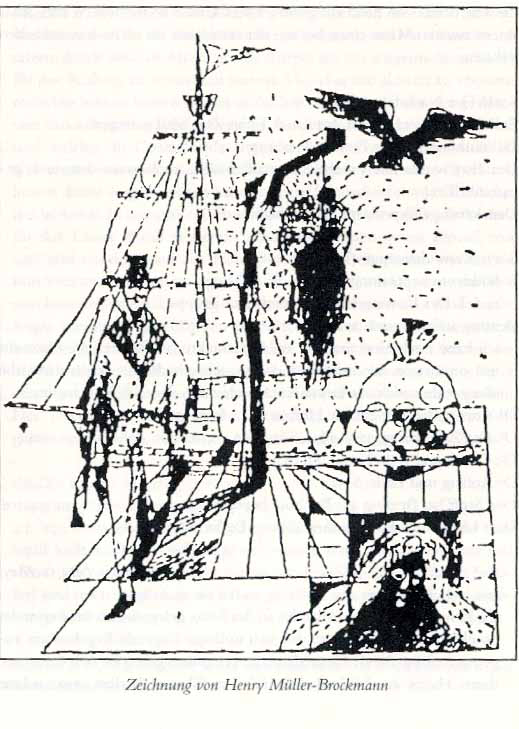
Der Sekt der Geizigen
Bei den Schotten, erzählt man sich, ist der Geiz ein weitverbreitetes Laster, und man weiß haarsträubende Beispiele davon zu berichten, aber das ist vielleicht nur üble Nachrede und arg übertrieben. Das Folgende sei drum nicht bei den kurzröckigen Hochlandsbewohnern angesiedelt, sondern wir bleiben im deutschen Vaterland, bei den Schwaben etwa, von deren Sparsamkeit viel daher gemacht wird, wir könnten es aber auch bei den Franken spielen lassen, oder auch bei den Bayern, die in den Bergen leben wie die Schotten, nur kurze Lederhosen tragen statt der bunten Röckchen.
In einer schwäbischen Stadt denn also, in Augsburg, oder in Memmingen, lebte ein so wohlhabener als geiziger Mensch, und beides fällt gern zusammen, ein Kaufmann, der mit Seilen und Stricken handelte, mit Fischnetzen und allerlei Angelgerät, und es ist schon eine Weile her, um die Zeit wars, da der Großvater die Großmutter nahm. Der Kaufmann hatte es mit der Galle zu tun, der Krankheit der mißmutig Sparsamen, und einmal lag er schwer und unter großen Schmerzen danieder. Spät erst, und nach langem Zögern, weil er die Kosten fürchtete, ließ er einen Arzt rufen. Der Doktor, der auch nicht zu den verschwenderisch Freigebigen gehörte, und dafür bekannt war in der ganzen Stadt wie der Seilhändler auch, kam also, der Geiz zum Geize, und wendete alle Geschicklichkeit auf, den Kranken zu heilen, und es gelang. Dessen Freude darüber war getrübt durch den Gedanken an die Rechnung, die er nun zu gewärtigen hatte. Er schalt sich, desto mehr, als es ihm von Tag zu Tag besser ging, voreilig gewesen zu sein, und vielleicht, haderte er mit sich, wäre er von selber wieder gesund geworden, hätte ers nur abgewartet und die Natur walten lassen, die viel vermögende. Er zerbrach sich lange darüber den Kopf, wie es anzustellen, ungerupft zu bleiben von dem grausamen Doktor, und es kam ihm endlich auch ein rettender Einfall, das heißt, es gerade heraus zu sagen, es war ein rechter Spitzbubenstreich, den zu verüben er sich anschickte.
Er hatte noch, da er natürlich alles aufhob und das Geringste nicht wegwarf, ein Dutzend leerer Sektflaschen im Keller stehen, französischer Herkunft, von seiner Hochzeit her noch vor zwanzig Jahren – inzwischen war er längst Witwer geworden. Die füllte er mit gutem Augsburger oder auch Memminger Brunnenwasser und verschloß sie auf die Weise, wie man es mit dem Sekt macht, mit einem Drahtgeflecht um die Korken und wickelte Silberpapier um die Flaschenhälse. Es war ein ziemliches Kunststück, das er da vollbringen mußte, und bei einem Fachmann hatte er, unter dem Vorwand, es handle sich um eine Wette, sich Rats geholt, und es gelang das schwere Werk. Die auf den Flaschen noch klebenden Zettel, die den Namen des Sekts, Herkunft und Jahrgang meldeten, waren angeschimmelt und hatten braune Stockflecken, sie ließ er, wie sie waren, die bezeugten das Alter des Weins, und der gewinnt ja nur durch langes Lagern.
Das Flaschendutzend schickte er, noch bevor er eine Rechnung von ihm bekommen hatte, dem Arzt, mit einem höflichen und schmeichlerischen Brief, des Inhalts, er, der Doktor, ein Kenner gewiß, werde den Sekt zu schätzen wissen: ein Getränk sei es für Herzöge und Erzbischöfe, aber seine Dankbarkeit für die gelungene Heilung sei groß, und nichts sei ihm zu teuer in solchem Falle. Seine, des Seilhändlers nicht falsche Überlegung war diese: Der geizige Doktor werde sich nicht überwinden, den Sekt sich alsbald durch die Gurgel zu jagen, oder gar ihn seinen sowieso seltenen Gästen vorzusetzen – für ihn, und erst recht für sie, tat es der schwäbische Landwein auch, und Sünden würde er sich fürchten, so Herrliches schnell zu vergeuden. Es geschah denn auch, wie der Kaufmann, seinesgleichen nur zu gut kennend, vorausgesehen hatte: Der Doktor bewunderte die verschimmelte Pracht, bedankte sich umständlich bei dem Geber, und ließ die Flaschen durch seine Magd in den Keller schaffen, sie aufzusparen für eine besondere Gelegenheit.
Die Jahre vergingen, der Kaufmann starb, nicht an seinem Gallenleiden, eine schnelle Lungenentzündung, zu deren Behandlung den Doktor herbeizurufen er für unnötig gehalten hatte, raffte ihn hinweg. Der Doktor ging trotzdem zu seiner Beerdigung, und gedachte, während der Sarg in die Tiefe sank, der Silberhalsflaschen in seinem Keller, und wie Unrecht hatte man dem Verstorbenen immer getan, ihn geizig zu nennen: er wußte es besser! Eigentlich wollte er am Abend dieses Tages eine der kostbaren Flaschen öffnen, einen guten Schluck zu nehmen, den Spender zu grüßen, aber er kam nicht dazu, man holte ihn zu einem Kranken, und als er spät zurückkehrte, war es Zeit, das Bett aufzusuchen, frisch zu sein für den nächsten Morgen, und so blieb das Flaschendutzend unangebrochen. Nicht lange danach segnete der Doktor selber das Zeitliche, betrauert nur von seiner alten Magd, denn, zu heiraten hatte er sich versagt, und keine Witwe grämte sich um ihn mit vielen Tränen.
Die Erben, entfernte Vettern und Basen, rüsteten einen großen Leichenschmaus, bei dem es so üppig herging, daß der Doktor im Grab sich umgedreht hätte, wär ihm zuzuschauen möglich gewesen. Zur Krönung des Festes, und da waren sie schon recht lebhaft geworden, holten sie auch von dem alten Sekt aus dem Keller, den Toten damit würdig zu feiern. Als die Kelche gefüllt waren, und man in fast ungebührlicher Fröhlichkeit anstieß auf das jenseitige Wohl des Verstorbenen, hielt die weinende Magd die Schürze vor das Gesicht und ging aus dem Zimmer. So sah sie nicht, wie die einen schnell innehielten mit dem Trinken, und husteten, und prusteten, und sich verschluckten, andre gar unbeherrscht den Sekt wieder von sich den Teppich – so faulig und verdorben. Trotzdem – für Wasser nahm das Getränk keiner! Und wenn sie auch von der Magd dann erfuhren, daß die Flaschen ein Geschenk gewesen des schon lange toten Seilhändlers – sein Wappenschild blieb fleckenlos, oder wenigstens, man sah den Flecken nicht! Die Erben beschlossen nun nach dieser Erfahrung, ihnen sollte dergleichen nicht geschehen, und sie wollten ihre Weine nicht zu lange lagern lassen, denn, scherzten sie, alt zu werden bekommt schönen Frauen nicht und nicht französischem Sekt.
Komödiantengeschichte
In der kleinen Stadt Honfleur, in der Normandie, nahe der Seinemündung gelegen, und seiner Stockfische wegen bekannt, hat sich, ein Menschenalter vor dem Bastillesturm in Paris, der ein neues, vernünftiges Zeitalter heraufführte, so wenigstens sagt man, das Folgende ereignet, und jedem steht es frei es lächerlich zu finden oder fürchterlich. Aber es ist so geschehen, es ist urkundlich verbürgt, und so muß es auch unerschrocken erzählt und angehört werden, und wer da gern die Augen verschließt vor dem wüsten Greuel des Lebens, wird leicht blind auch für sein Liebliches.
Eine Truppe von Schauspielern war in der Salzfischstadt eingetroffen. Ihr Anführer war ein ehemaliger Latwergenhändler, der über der rechten leeren Augenhöhle eine schwarze Binde trug, aber mit dem ihm verbliebenen linken Auge sah er scharf genug, und mehr als manchem lieb war, seine Leute wußten es. Im Saal des Wirtshauses brachten sie liederliche Schwänke und Possen zur Aufführung und hatten großen Zulauf aus dem gemeinen Volk. Auch gesetzte Bürger fanden sich ohne Scheu ein, die aber ihre Weiber zu Hause ließen, und junge Herren vom Adel, die mit ihren Degen ein vornehmes Geräusch machten, und in den Pausen Wein und Zuckerzeug und rosarote Briefchen den Frauenzimmern hinter die Bühne bringen ließen – sie wurden meist gnädig und gewährend angenommen.
Einmal verlangte ein Stück, das in einer feurigfrechen Eifersuchtsszene gipfelte, daß der Harlekin, ein bildhübsches Bürschchen von kaum zwanzig Jahren, ein bartloses Milchgesicht, von dem hitzigen Nebenbuhler durch einen Messerstich getötet werde. Der Darsteller des Nebenbuhlers, ein schon älterer Mensch mit dunkel glühenden Augen, mit der munteren Tochter des Latwergenhändlers unruhig verheiratet, machte das so gut und echt, daß der Harlekin gleich nach dem Fallen des Vorhangs starb – auf offener Bühne zu verscheiden hatte er vermieden mit letzter Kraft, in dem Pflichtbewußtsein, das Schauspieler so oft auszeichnet. Der gestochen hatte, zerraufte sich das schwarze Haar und warf sich, laut jammernd und sich anklagend, zu Boden, und verfluchte seine unglückliche Hand. Aber nicht alle glaubten ihm, daß es nur ein Versehen gewesen war, nur hütete sich jeder es auszusprechen. Auch die Polizei begnügte sich schnell mit der Meldung, ein Komödiant sei durch einen Berufsunfall ums Leben gekommen – das geschah des öfteren, Seiltänzer stürzten ab, Feuerfresser verbrannten sich, und solch unehrlicher Leute einer mehr einer weniger, was machte das schon aus?
So weit nun gut und schön, doch als der einäugige Latwergenhändler, ein Mann, der auf Sitte und Herkommen hielt, den zuständigen Pfarrer auf das höflichste bat, und dabei vernehmlich mit den Geldstücken im Hosensack klimperte, ein Begräbnis vorzubereiten für den Verunglückten, lehnte der geistliche Herr das mit vielen bedauernden Reden ab, auf seine oberhirtlichen Vorschriften hinweisend, die es ihm nicht erlaubten, Fahrende mit den kirchlichen Segnungen versehen auf einem geweihten Friedhof zu bestatten. Er seufzte, als er das sagte, vielleicht noch das Klimpern im Ohr, und der Latwergenhändler rückte an seiner schwarzen Binde und verbeugte sich und ging.
Nun hatte vor kurzem erst das fortschrittlich gesinnte Parlament in Paris eine Verordnung erlassen, derzufolge in Fällen dieser Art auch das weltliche Gericht ein Wort mitzusprechen habe, und der Latwergenhändler, gekränkt und rechthaberisch, strengte eine Klage gegen den Pfarrer an, des Inhalts, diesem sei aufgegeben, dem Erstochenen, der ein getaufter Christenmensch gewesen, ein ehrliches Grab nicht zu verweigern, auf daß man ihn nicht zu verscharren brauche wie eine räudige Katze.
Langsam und schwerfällig arbeiteten auch damals schon die Behörden, und bis eine Entscheidung fiel, das mochte eine geraume Weile dauern, und bis dahin war die Leiche der viel schneller als die Behörden arbeitenden Verwesung anheimgegeben. Ihr Einhalt zu gebieten, kam ein Mitglied der Truppe, ein der Hochschule entlaufener Tunichtgut, der Wundarzt hätte werden wollen, auf einen tollen Einfall, und es kann nicht anders sein, als daß es das Vorbild und die Luft der Salzfischstadt Honfleur waren, die diesen Gedanken in ihm weckten. Er konnte es ja rings mit Augen sehen, wie man die Fische durch Einsalzen vor dem vorzeitigen Verderben zu bewahren verstand, und warum, dachte er, sollte das nicht auch bei dem im Tode noch so anmutig anzuschauenden Jüngling gemacht werden können, damit man für den Tag der Beerdigung einen wohlerhaltenen Leib in Bereitschaft habe. Er erinnerte sich von der Schule her, daß die alten ägyptischen Ärzte schon Mittel anwandten, ihre Könige in gutem Zustand in die Grabkammern zu legen, und so ähnlich königlich sollte es dem Harlekin auch geschehen – das war sein Wille!
Die Kosten für das Salz zu sparen, sammelte der von seiner Aufgabe schon ganz Besessene von dem Salz, das von den Stockfischen fiel, wenn sie aus den Schiffen ausgeladen und in die Schuppen der Händler getragen wurden. Alle armen Leute Honfleurs versuchten so, sich billig das weiße Gewürz zu verschaffen, obwohl es natürlich verboten war, denn die Stockfischhändler ließen das Geringste nicht sich entgehen von dem Ihrigen, und nur auf diese Weise wird man reich. Der fürchterliche Mensch also begann zu tun, was er sich vorgenommen hatte, alte, fast vergessene Wissenschaft zu nützlicher Anwendung bringend, mit aller Hingabe, ja, mit einem einfältigen und frommen Stolz und recht als gutes Werk, wie er in seiner Verwirrung meinte. Kaum war er fertig geworden, kam ein Salzbedienter gelaufen, der von dem Diebstahl gehört hatte, mit einem Polizeibüttel kam er, und ließ den Salzdieb auf der Wache festsetzen – um den so königlich behandelten Toten kümmerte er sich nicht, das fiel nicht in sein Amtsbereich! Zwar kratzten jetzt die Schauspieler ihr Geld zusammen, eine Sicherheit für den Gefangenen zu stellen, und man gab ihm auch bald die Freiheit wieder, bis der Stadtrichter sein Urteil gefällt haben würde. Nun hatten die fahrenden Leute einen zweiten Prozeß auf dem Hals, und ihrem Oberhaupt, dem Latwergenhändler, gefiel das gar nicht, und er sah Unheil kommen mit seinem noch sehenden linken Auge.
Er rückte an seiner schwarzen Binde, wie immer, wenn es einen Entschluß zu fassen galt, und dann ordnete er an, zu tun, was oft schon in Bedrängnissen ihre Rettung in letzter Stunde gewesen war: sich heimlich, und bei Nacht und Nebel, und mit Sack und Pack davon zu machen, von den Füßen den Staub schüttelnd der ungastlichen und grausamen Stadt. Den Harlekin ließen sie zurück, und der Wirt mochte nur ruhig mit ihren unbezahlten Rechnungen ein Feuerchen im Ofen anzünden, sich eine Wurst drauf zu braten: er hatte genug an ihnen verdient durch die vornehmen Gäste, die sie in sein minderes Haus gelockt hatten. Der Herr sei ihm gnädig, sagten sie, und meinten den Wirt nicht, meinten den Harlekin, und schlugen das Kreuz über den toten Kameraden, und die Tochter des Latwergenhändlers weinte sogar.
Der Salzbediente, als er von der Flucht der Truppe hörte am andern Morgen, machte sich eilig zu dem Wirtshaus auf. Er sah den Toten, und weil er glaubte, der sei ein für ihn kostbares Pfand, und die Schauspieler würden vielleicht doch einen Boten schicken, es auszulösen, bemächtigte er sich des Dahingeschiedenen und schaffte ihn auf einem Karren in eins der Stockfischlager.
Nie wieder aber ließ sich einer der Truppe in Honfleur blicken, und nicht für lange konnte der Salzbediente den stummen Harlekin bei den stummen Stockfischen haben. In seiner Not versuchte er zu erreichen, was schon der wortgewaltige Latwergenhändler nicht erreicht hatte, den geistlichen Herrn nämlich dazu zu bewegen, dem Jüngling nun doch noch ein Begräbnis zu gewähren, auf Armenkosten natürlich, und in der billigsten Klasse. Aber der Gottesmann schlug entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen, als er von dem Vorgefallenen hörte und beharrte jetzt erst recht auf seiner Weigerung, den Harlekin neben den Bürgern der Stadt zu betten.
Der Salzbediente, es ist zu verstehen, war voll Kummer und sah keinen Ausweg mehr aus dieser Verfahrenheit, und fest nun entschlossen, dem Trubel ein Ende zu machen, legte er in einer schwarzen Nacht den toten Schauspieler wieder auf den Handkarren und karrte ihn, und es ärgerte ihn, daß die ungeschmierten Räder so laut knarrten, zur Seine hinab, und warf ihn in das geduldige Wasser, das bei Honfleur ins Meer fließt. Und die Wellen des Flusses trugen den gesalzenen Leichnam in das weite, salzige Wasser.
Der unbestrafte Mörder, angenommen, es habe sich um einen überlegten Mord gehandelt, was niemand wissen konnte, nur er, ja, selbst er nicht mit Sicherheit, denn ihm waren vielleicht Spiel und Leben ein und dasselbe geworden in einer undurchdringlichen Sekunde – er nun also lebte wieder still und zufrieden mit der Tochter des Latwergenhändlers. Und wenn ihn des Nachts böse Träume peinigten und ihn weckten, und er dann schlaflos lag, und neben ihm atmete die Frau, und sie auch nur konnte wissen, ob sie mit dem Harlekin bloß getändelt hatte, oder ob es mehr gewesen war – so griff er nach dem Krug mit rotem Wein, den er nie vergaß abends ans Bett zu stellen, und der vermag viel.
Das hinkende e
Wir hatten einmal, es war in einer der untersten Klassen der Mittelschule, ja, ich weiß es genau, es war die dritte Klasse, ich weiß es genau, weil ich sie zweimal durchlief, nicht durchlief, durchstolperte (was gab es da an Hindernissen und Fallgruben, an Wolfslöchern und Fußangeln!) – in dieser dritten Klasse also hatten wir einen Lehrer für Deutsch, der war sehr durchschnittlich begabt, und tat uns auch nicht viel zuleid, man durfte ihm nur in einem Punkt nicht wehe tun, da war er empfindlich wie ein Pferdemaul gegen Hornissenstiche. Und das war so, es klingt unglaublich und komisch, aber es ist wahr, er verlangte, wenn man den Buchstaben e das kleine e das kleine deutsche e schrieb, daß man da den zweiten e-Strich etwas kürzer mache als den ersten. Das war früher allgemein üblich gewesen, alte Leute tun es heute noch, aber zu unserer Zeit war das schon nicht mehr Sitte, aber er, der Deutschlehrer, verlangte es von uns.
An der schwarzen Tafel malte er uns das Muster-e hin, das beispielhafte, es sah ein bißchen hinkend aus, denn standen die e-s, die wir gewohnt waren zu schreiben, auf zwei gleich langen, festen Beinen unerschütterlich und stramm und ordentlich da, so glich das e, das er gebieterisch forderte, einem Invaliden, einem Stelzfuß, einem Kriegsbeschädigten, dem man das eine Bein unterhalb des Knies abnahm. Aber ihm schien dieses verstümmelte Zeichen besonders liebenswert, und wir Schüler nun, wenn man nichts Schwereres von uns verlangte, das konnten wir leisten, wahrhaftig, und wir leisteten es.
Ich träumte viel damals, nicht nur im Schlaf, da träumt jeder, da träumte ich auch, aber auch mit offenen Augen war ich abwesend (wo nur überall!) und träumte davon, berühmt zu werden, und wußte nur nicht recht, wie. Eine Spur mußte man von sich hinterlassen, irgend etwas tun, was noch Jahrhunderte nachwirkte, und da kam mir der Lehrer mit seinem e gerade recht. Wenn ich, träumte ich, in allem, was ich schrieb, nicht nur in den deutschen Aufsätzen, nein, auch in allen anderen Arbeiten, in der Naturkunde zum Beispiel, in jedem Fach, ja auch in jedem Brief, den ich an Freunde, an Verwandte schickte, in allem Schriftlichen, das ich aus der Hand ließ, das Kurzbeinige anwendete, so würde das Nachahmer finden.
Da und dort im Land würden Leute aufstehen, die mir darin folgten. Meine Freunde konnte ich bitten, auch ihrerseits das umstrittene Zeichen nur in der kurzbeinigen Fassung aus der Hand zu geben. Und das würde ich mein ganzes Leben hindurch so halten, und wenn ich erst groß sein und Kinder haben würde, so war es ganz klar, daß die mir nachfolgten und das e malten wie ich, und die Kinder meiner Freunde würden es auch tun und deren Kinder wieder und so durch viele Geschlechter. Ich träumte davon, auch Lehrer zu werden, und natürlich meine Schüler davon zu überzeugen, daß das Invaliden-e das einzig richtige, das einzig schöne sei, und von den Schülern würden wieder ein paar Lehrer werden dereinst und unsere, die kurzbeinige Fassung verbreiten und vielleicht, wenn wir alle recht zusammenhielten, so konnte es gelingen, daß man auf dem ganzen großen Erdball das gleichbeinige e besiegte und im Triumph das alte, gediegene auf allem Papier zu finden war.
Welch eine Tat, dachte ich, das zu leisten, und sich zu denken, daß auf dem dicken, gelben Pergament, auf dem man einen künftigen Friedensvertrag niederschrieb, mein e, denn mein e war es nun geworden, herrlich erglänzte! Und wenn die Weltgeschichte, träumte ich, wie man uns gesagt hat, das große Buch der Menschheit ist, in der von allen riesigen Taten unvergänglich erzählt wird, und seine Blätter sind, wie man uns auch sagte, mächtige Tafeln, auf denen goldene Lettern stehen, nun, zu den Lettern, sogar zu den am häufigsten gebrauchten, gehört das e. Und das würde in meiner Fassung ruhmvoll in die Jahrtausende schreiten, und noch von mir zeugen, wenn ich längst unter der Erde lag, vergessen und vermodert, wie von dem verschollenen und namenlosen Sänger das Lied bleibt, das auf aller Lippen ist, landauf und landab.
Ein Kastanienbaum blühte vor unserem Schulfenster mit großen, fast handgroßen Blättern, dunkelgrünen, und mit vielen weißen Kerzen, die im Frühlingswind leise schwankten, und ein Vogel, ein Star, saß auf einem Ast und pfiff, und ich träumte mir meinen Ruhm. Caesar ritt heran, goldgepanzert, mit kühnem Gesicht, und hinter ihm römische Kohorten, in Viererreihen, in Sechserreihen, schauten kühn wie er, trugen den Adler an der Stange, der flog auf und rauschte, breitflügelig um des Imperators blaugeäderte Schläfen. In einer Tonne saß der schmutzige Diogenes, Columbus fuhr in seiner Caravelle übers Meer, Napoleon drückte das fette Kinn auf die weiße, schnupftabakgebräunte Weste, Helden überall! Die Dichter sangen ihren Ruhm, schrieben Bücher, viele, viele Bücher, dicke und dünne, mit vielen, vielen Buchstaben und hinter jedem Kapitel drein hüpfte und tanzte, wie auf der Dorfkirchweih nach dem Siebenjährigen Krieg der gewesene Dragonerwachtmeister, der stelzbeinige Buchstabe e.
Die Mückenschlacht
Die Schwüle lag wie ein großes, heißes Tier vorm Fenster mit zitternden Flanken. Sie war da, hingelagert, breitbäuchig, schwappelbäuchig, zündholzkuppenrote Tupfen auf dem gelbhäutigen, pilzfaltigen Drachenbauch, und atmete schwer, trompetenstößig, im Blasbalgtakt. Die Zunge, die feuerfarbene, feuerwarme Zunge rauchte über den Dächern. Mit dem Atem stieß die Bestie Schwärme kleiner, gelbgeflügelter Mücken aus.
Die hingen wie Fahnen in der Luft, steil und schräg, gebauscht und seilig verknäuelt, mit flatternden Zipfeln und unbewegt, wie Wasserfall rauschend, wie zum Teppich verwebt. Am Abend begannen sie ungeheuer und klingend zu tanzen. Sie drehten sich in rasenden Wirbeln, brachen wütend über die Stube herein und schwangen wie verdorrte Kränze um die Lampe. Es waren Hunderte, Tausende. Die Stube begann sich mit ihnen zu drehen. Sie verfinsterten das Licht. Sie schnurrten wie rasende Rosenkranzkugeln gegeneinander, Flügelzentauren, ein Hunnenheer ohne Hufegetrappel.
Wir warfen die Netze unsrer Finger unter sie, schlossen die Faust und hielten die kleinen, zuckenden Körper gefangen. Wir erschlugen sie mit Tüchern, verfolgten sie mit brennenden Kerzen, ihnen Scheiterhaufen zu errichten.
Aber ihrer wurden immer mehr und die Bogen ihrer wilden Kreise immer gewaltiger. Sie zwangen uns, bei geschlossenen Fenstern zu sitzen. Wenn wir an die Scheiben traten, sahen wir sie gierig am Glas kleben. Wir fürchteten uns. Wir zogen uns in die dunkelste Ecke der Stube zurück wie Höhlenbewohner, grobknochig wurden wir und keulenschwingend, lang Haar und Bart und starrten auf die feindlichen, die tödlichen Ungeheuer.
Jeden Abend mußten wir die gläsernen Verhaue herablassen. Wir lehnten müde in den Sesseln. Mit feuchten Fingern drehten wir uns Zigaretten. Von Zeit zu Zeit ging einer zum Fenster, wo von draußen mit leisem Knall die Mücken gegen das Glas taumelten. Wir waren belagert, eingesperrt, sie lauerten immer auf uns. Die schwülen Nächte dampften unter dem Mond. Uns ergriff ein wilder Haß gegen unsre Feinde. Wir töteten sie, wo wir sie vereinzelt antrafen. Wir öffneten das Fenster ein wenig, daß durch den kleinen Spalt taumelnd eine Schar hereinwogte. Wir erschlugen sie alle. Unser Gefangenenleben wurde unerträglich. Der Schweiß zerfraß uns. Wir machten Ausfallpläne, überlegten, ob es möglich sei, mit qualmenden Pechfackeln und lärmenden Glocken schwingend uns durchzuhauen. Wir träumten davon, sie in Massen mit breiten, glühenden Schaufeln zischend zu erschlagen. Unsre Nasenflügel blähten sich bei der Vorstellung, das verbrannte Fleisch zu riechen. Dann lagen wir wieder erschöpft über den Tischen. Und immer die gierigen Flügelflatterer an den Scheiben.
Eines Abends erstach ein schneller Blitz das große Tier. Ein Messer kam aus den Wolken gefahren und zischte wie in Butter in den gelbfaltigen Drachenbauch. Wie Regen verschwamm das Blut. Der mückenspeiende Atem erlosch. Wir schlugen die Fenster weit auseinander. Die Kühle stieg zu uns herein, eine tiefe Bläue erfüllte das Zimmer.
Im brennenden Feuerofen
Es traf uns, daß wir – es war im Kriegsjahr 1917 – abends abzulösen hatten, in Flandern, in einer uns neuen Stellung, an einem unruhigen Abschnitt, und wir vier, von jeder Kompanie ein Offizier, wollten, an einem blauen Mainachmittag, vorher schon wenigstens die Zumarschwege erkunden. Wir waren auf unseren Rädern unbehelligt bis zu einem im wuchernden Grün versteckten zerschossenen Dorf gekommen, das dicht hinter den Gräben lag, die wir zu besetzen hatten, und fühlten uns nun sicher, sie auch in der Dunkelheit zu finden, zumal uns abends, bei der Kirche, Führer erwarten sollten, die mit dem Grabennetz vertraut waren. So begannen wir also unverweilt die Rückfahrt.
Die Straße war in keinem guten Zustand, vom Regen ausgewaschen und von Granattrichtern übersät. Wir fuhren noch nicht lange, da rauschte es hinter uns in der Luft, und wir brauchten uns nicht erst umzusehen, das Rauschen kannten wir, von manchem Tag und mancher Nacht. Die erste Granate schlug dicht hinter uns ein, und eine zweite dann, und der Luftdruck schob uns voran, als hätte uns der Stoß einer Riesenfaust getroffen. Es folgten noch mehr Schüsse, und sie galten uns, das war nicht schwer zu erraten, und jetzt schmetterte es wie bei einem Schmiedehammer gewaltig mitten vor uns auf den Weg nieder. Wir sausten auf die Erdfahne los, die steil und prasselnd auffuhr, ein Regen von Steinen und Lehmbrocken polterte herab: Hindurch! – und schon wieder heulte es verderblichen Tons heran und zersprang krachend.
Ich hielt die Lenkstange so fest umklammert, daß mir die Hände weh taten, und konnte es, neugierig noch im Höllenlärm, nicht lassen, einen Blick zur Seite zu werfen. Neben mir fuhr ein Mann, und das Gesicht dieses Mannes kannte ich doch; seit Jahren war es mir vertraut, und erkannte es nun kaum wieder, so war es verändert. Jetzt eben war mein Nebenmann mit dem Vorderrad in eine Wagenspur geraten, er schien stürzen zu wollen, aber er kam dann doch wieder ins Gleichgewicht, und länger als diese winzige Spanne Zeit konnte ich nicht zu ihm hinüber schauen. Ich hatte genug mit mir selber zu tun, denn schon wieder sang und orgelte es ohrenbetäubend auf uns herein. Aber das Gesicht vergesse ich nicht, dieses Fahrers im Feuer, der um sein Leben fuhr. Das Gesicht drückte nicht Todesangst aus, nein, das nicht, der Mann hatte gar keine Zeit, Todesangst zu haben, und sein Gesicht, ein braves Männergesicht sonst, wie viele, war von einer fast geisterhaften Schönheit jetzt, da er allen Willen angespannt hatte, schnell zu sein, und schneller als die glühenden Vögel, die uns klirrend verfolgten.
Wir entkamen ihnen auch. Und wenn ich ein Maskenschnitzer wäre, und aus dem Holz ein Antlitz formen sollte, darin jeder gleich sollte lesen können, daß sein Träger begabt sei, schnell zu sein wie der eilende Windgott selber, ich wüßte keins zu finden, als das des Offiziers damals im feurigen Flandern. Und ich habe nur einmal etwas erlebt, das mir, was Schnelligkeit sei, in ebenso unverlierbarem Bild vor Augen stellte. Das war viel früher gewesen, nicht in Flandern, in der alten Donaustadt, der türmereichen, in meiner Knabenzeit.
Wir hatten zu Hause eine Katze, ein schönes, schwarzes Tier mit glänzendem Fell, und wir liebten es alle eifersüchtig, Vater, Mutter und wir Geschwister, aber die Katze, glaube ich, liebte uns nicht, wie Katzen schon sind. Sie duldete gnädig unsere Zärtlichkeiten, aber oft, während ich sie streichelte und glücklich war, daß sie sich herabließ zu schnurren, richtete sie sich plötzlich auf, und auf einmal spürte ich, daß sie auch Knochen hatte: wenn sie auf meinem Schoße sonst lag, spürte ich das nicht. Dann sprang sie auf den Boden, ging nachlässig fort, ohne sich auch nur umzusehen, ohne auf meine Lockworte zu hören, irgendwohin, wohin es sie die Lust ankam, in eine Ecke, aufs Fensterbrett.
Das schwarze Tier konnte es nicht heiß genug haben. Im Sommer lag es lange Stunden in der Sonne, und in der kühlen Jahreszeit hielt es sich gern in der Küche auf, wo auch an den Tagen, an denen das Wohnzimmer nicht geheizt war, die Kohle im Ofen glühte, und oft verbrachte es die Nachmittage auf der Herdplatte, die noch die Wärme vom Mittagessenfeuer aufbewahrte. Einmal nun, im Frühherbst, wurde, was nur hin und wieder vorkam, auch des Abends noch einmal der Küchenherd angeschürt. Meine Mutter hatte es selbst getan, und mich dann in die Küche geschickt, nachzusehen, ob das Feuer denn auch ordentlich brenne.
Es war schon dämmerig, als ich die Küche betrat. Aus dem Aschenloch fiel rote Glut über den Boden, und die zinnernen Teller über dem Ofen glänzten geheimnisvoll. Und dann hörte ich ein sonderbares Geräusch, trappelnd, dumpf, hohl, als schlüge jemand mit einem Stock, an dem vorn ein Wollknopf befestigt ist, rasch gegen Blech. Ich sah mich erschrocken um, nach Räubern und Dieben; aber ich war allein, vom Ofen kam der Lärm her, und er wurde nur immer heftiger.
Vielleicht, dachte ich, kracht das Holz im Herd so, vielleicht war ein mit Harz durchsetztes Scheit ins Feuer gelegt worden, das knallte wie Flintenschüsse, wußte ich aus Erfahrung. Jetzt schwoll das Getrappel mächtig an, als ritte eine Schwadron Husaren über Kopfsteinpflaster. Und nun glaubte ich zu hören, daß der Lärm aus der Bratröhre kam, und ohne lang zu überlegen, wie es darin so donnern könne, riß ich die Türe zu dem schwarzen Gehäuse auf und heraus schoß, wie ein geschwänzter, feuriger Teufel unsere Katze, in einem einzigen, gewaltigen Satz, flog, ohne den Boden zu berühren, wie ein abgefeuertes Geschoß bis zur offenen Küchentür und durch die Tür hinaus und verschwand ohne Laut. Und nie wieder seitdem verschloß meine Mutter, ohne sich vorher davon überzeugt zu haben, daß sie auch leer sei, die Bratröhre.
Es ging mir lange schaudernd nach, im Wachen und im Traum, daß ich aus dem Schlaf oft emporfuhr, mir vorzustellen, wie die Katze, als der Boden unter ihr anfing sich zu erhitzen, von Fuß auf Fuß trat, immer schneller, immer rasender, im engen, schwarzen Raum, von sechs Blechwänden umgeben, dem roten Tod preisgegeben, wie jener Jüngling fast im Feuerofen, aber sie sang nicht wie der, die stumme.
Und ich meine heute noch, gesehen zu haben, daß, als die flüchtende Katze aus der schwarzen Röhre sauste, eine Wolke von Glut und Rauch sie umloderte – ihre Haare hatten wohl schon begonnen zu glimmen. Und manchmal, wenn mir die Windgottesmaske des Offiziers, damals, im feurigen Flandern, in der Erinnerung aufsteigt, fliegt neben ihm durch die Lüfte die Feuerkatze, rauchumwallt, beide, Mensch und Tier, vom nahen Tod ins atmende Leben geschnellt.
Das Tier hatte übrigens keinen ernsthaften Schaden genommen, stellten wir dann fest, als wir es unter dem Bett hervorholten, wohin es sich knurrend verkrochen hatte. Zwar die schwarzen Ballen unter seinen Füßen trugen Brandwunden, aber es ließ sich geduldig Öl darauf streichen und ließ sich verbinden, und humpelte dann auf vier weißverbundenen Beinen herum. Und als man ihm die Verbände abnahm, die Wunden aber noch nicht gänzlich verheilt waren, hielt es sich am liebsten im Hausgang auf, der mit Steinen gepflastert war – das war wohl kühlend.
Die Könige sind unterwegs
Der Schnee fiel schon seit Stunden, dick und fett und weiß, und so war nicht zu sehen, ob es Kartoffelfelder waren, die sich da hindehnten, ob Weizensaat hier keimte oder junger Roggen, vielleicht waren es Wiesen, weil ja alles weiß war, gleichmäßig weiß, wattebauschig weiß. Ein Dorf, nicht fern, das sah aus, als habe ein großmächtiger Maulwurf einen überschneiten Berg aufgewühlt, und vielleicht würde er, der unsichtbare schwarze Pfotenschaufler, den Berg noch höher wölben, immer höher, immer höher ! Und es fiel Schnee, das würde nimmer aufhören heut, morgen auch nicht, vielleicht übermorgen, wenn überhaupt je. Wahrscheinlich lief neben der Straße ein Straßengraben. Aber zu sehen war er nicht, so war er angefüllt mit Schnee.
Drei Männer kamen die Straße daher, und es war wunderbar genug, daß sie immer noch die Straße unter den Füssen hatten, sie wußten auch nicht genau, ob es immer noch die Straße war, vielleicht gingen sie schon längst querfeldein. Bis an die Knie reichte ihnen der Schnee, und besonders Balthasar, der Neger, litt unter der Kälte, und sein roter Mantel hätte besser zum gelben Wüstensand seiner Heimat gepaßt (wie war sie fern!), als zu dieser weißen Winterlandschaft, aber er ging unverdrossen hinter Kaspar und Melchior drein. Kaspar hatte einen langen, spitzen Bart, weiß wie der Schnee, und trug einen schwarzen Mantel, der geräumig um ihn wogte, und Melchior war bartlos und faltenfrei im Gesicht, und sein Mantel war gelb, und um die Hüften herausfordernd eng geschnitten. Sie gingen im Gänsemarsch, einer trat in die Fußstapfen des anderen, und da zeigte es sich, daß der Neger die kleinsten Füße hatte von den dreien, denn seine silbergeflochtenen Schuhe hätten gut zweimal Platz gehabt in den tiefen Gruben, die seine Vorgänger traten. Und einmal machte es ihm Spaß, das zu versuchen, in einer Grube Fuß vor Fuß zu setzen, Silberschuh vor Silberschuh, und so stehen zu bleiben. Wie komisch der schwarze Mantel Kaspars sich blähte !
So gingen sie und sahen manchmal zum Himmel auf. Der war nicht zu sehen, nur Schnee sah man herunterfallen, aber der Himmel war schon noch da, o ja, unerschütterlich, der Himmel, denn sie sahen den Stern: zwar nur laternenklein, zartrosafarbig war er, ein Sternlein nur, winzig im schwarzgrauen Flockenfall, aber er war da, war noch da und führte sie.
Das Dorf, das Maulwurfsdorf, blieb auch schon zurück, und sie gingen immer weiter, und Balthasar schüttelte den Rotmantel, ihn von der Schneelast zu befreien, und der spitzbärtige Kaspar blies in die erstarrten Hände, sie aufzutauen, und der dicke Melchior stampfte mit den Füßen, weil sich an seinen Absätzen Schneeballen bildeten und zu Eis wurden, was das Gehen erschwerte.
Zur linken Hand an der Straße, wenn es noch die Straße war, auf der sie gingen, stand ein starker Baum mit vielen Ästen, knorrigen und lustig verdrehten, und als sie bei ihm waren und wieder einmal zum Himmel aufschauten, war der Stern schon noch da, der Rosastern, aber er glühte plötzlich stark auf; wie ein riesiges Katzenauge, funkelte, es war zum Fürchten, einen Augenblick lang waren Baum und Himmel und der unendliche Schnee rosarot, weithin alles rosarot, dann erlosch er, war weg, wirklich, er war weg, fort, und der Schnee wieder weiß. Der Mohr im roten Mantel schrie: »Habt ihrs gesehen ?« Sie hatten es natürlich alle drei gesehen, blieben alle drei unterm Baum stehen. »Dann muß es hier sein, irgendwo in der Nähe«, sagte Kaspar, »aber wo ?« »Wir warten hier«, entschied Melchior.
Sie ließen sich unter dem Baum nieder, breiteten eine Decke aus auf dem Schnee und setzten sich und hüllten sich fest in ihre Mäntel, daß sie waren wie drei merkwürdige Vögel, ein blutroter, ein rabenschwarzer und ein gelber. Sie sprachen nichts, der Schnee fiel lautlos, und der junge Balthasar wiegte den Krauskopf hin und her, immer hin und her, daß die goldenen Ringe an seinen Ohren klirrten. Dann hielt er den Kopf ruhig, die Ohrringe schwiegen, da war nur mehr der lautlose Schnee.
Wahrscheinlich waren sie eingeschlafen und erwachten von einer Stimme, die sie anrief, und sie wachten alle drei gleichzeitig auf; und da stand vor ihnen ein Mann, der hatte einen grauen Bart, grau wie das Fell des Esels, den er am Zügel führte, und auf dem Esel saß eine Frau. Das Tier schnappte mit weichem Maul nach dem roten Mantel des Mohren, und der Mann fragte: »Ist hier kein Dorf in der Nähe? Es wird Abend, und wir sind müd und suchen ein Unterkommen.« So fragte der Mann, und Balthasar, der ihn scharf beobachtete, bemerkte doch nicht, daß sich irgend etwas bewegt hätte in dem Gesicht des Fragers. Denn, wenn auch seine Lippen vom Bart bedeckt waren, hätte man doch diesen, den Bart, sich rühren sehen müssen, oder die Wangen sich heben, oder die Nasenflügel, aber das alles geschah nicht. Das Gesicht des Mannes blieb still und unbewegt, auch während er sprach; Balthasar verwunderte sich und stand auf; und da standen die beiden anderen auch auf; und Kaspar sagte: »Da hinten ist ein Dorf; eine halbe Stunde zurück, und ihr werdet dort schon finden, was ihr sucht !«
Der Mann nickte dankend, und die Frau nickte, und der Mann trieb den Esel an, der den roten Mantel ungern aus dem Maul ließ, und dann verschwanden Mann, Frau und Tier im Schneetreiben.
Balthasar dachte darüber nach, ob wohl seine beiden Gefährten es auch beobachtet hätten, daß der Graubart mit stummen Lippen hatte reden können und wollte sie fragen, da sagte Kaspar: »Sie sinds!« — »Wer«? fragte Melchior. »Wer?« fragte Balthasar und rieb an seinem Mantelärmel, der feuchtwarm war von der Eselmaulnässe.
»Sie sinds!« wiederholte Kaspar und bekam ein ganz frommes Gesicht. Balthasar schrie wütend: »Sie sinds! Sie sinds! Ein Mann war es und eine Frau und ein Esel! Aber wir suchen doch ein Kind!« Der zornige Mohr drehte die Augen, daß man das Weiße sah. Und plötzlich, wie flehend, sagte er mit leiser Stimme: »Ein Kind doch suchen wir!«
»Ihr habt nicht gesehen«, fragte Kaspar, fragte es sanft und lächelte dem Neger ins Gesicht: »Ihr habt nicht gesehen, daß die Frau gesegneten Leibes ist?«
Der Mohr wurde selig bleich, Melchior fing mit der Hand eine Schneeflocke und hielt sie wie eine Hoffnungstaube, und der weiße, scharfäugige Kaspar fragte: »Habt ihr eure Geschenke bereit?«
Und sie holten aus den Manteltaschen Gold in blanken, runden Stücken, würzige Hölzer und Öle in kostbaren Flaschen.
Sie setzten sich wieder, im Schneewirbel, und vor ihnen lagen die Geschenke im Schnee, und die Flocken tanzten darüber, aber keine einzige ließ sich darauf nieder, nicht eine, und sie glänzten unberührt, bis sie zuletzt in einer Mulde lagen, wie in einer Schneeschüssel mit weißen Schneewulsträndern.
Die drei Könige saßen die ganze Nacht, sie froren nicht, sangen leise Lieder vor sich hin, Balthasar ein seltsam verschnörkeltes, afrikanisches, Kaspar ein brummendes, dumpfes, und Melchior sang auch, aber nicht schön, und lachte dazwischen, und sie sangen und erwarteten den Morgen.
Der kam, die Sonne kam, es schneite nicht mehr, der Baum glänzte im Licht, und aus der Tiefe der Schneeschüssel leuchteten die Geschenke. Sie nahmen sie an sich, und Kaspar rief: »jetzt zu dem Dorf!«
Sie drehten um, Kaspar voran, dann Melchior, dann der schwarze Balthasar im roten Mantel, und nahmen die Richtung auf das Maulwurfsdorf, das sie gestern gesehen hatten.
Und der plattnasige Mohr, der jüngste der drei, fast ein Knabe noch, blieb plötzlich in einer Fußstapfe stehen, Silberschuh vor Silberschuh, weil ihm wieder eingefallen war, wie der Graubart gestern hatte reden können, ohne daß sein Gesicht sich rührte.
Wenn sie jetzt auf ihn trafen, wollte er sich das genau betrachten.
Der gemalte Sommer
Weit hinten lag das Dorf zierlich, wie aus der Spielzeugschachtel die Häuser und die Kirche, und hoch über dem Dorf schwebte eine kleine, eisengraue Wolke: die hatte das Aussehen eines ruhenden, krauswolligen Lammes, und in dieses Wolkenlamm war wie ein Feuersäbel der Blitz gefahren und hatte es durchbohrt, bös und mitleidlos, und unten aus dem Bauch sah die Spitze des Säbels fürchterlich hervor. Unbeweglich stand die Wolke und unbeweglich steckte der gelbrote Blitz in ihr. Alles auf dem Bilde sonst war heiter und friedlich, der Himmel heiß und blau und leer. Rechts hinten trennte der schwärzliche Zug eines Waldes Himmel und Erde und aus dem Dorfe schlängelte sich der hellblaue Faden eines Baches.
Da der Maler dieses Bildes, und mehr noch der gewissenhafte Schulmann, der es so, genau so, zu malen befohlen hatte, glauben mochten, daß man Stadtkindern nicht deutlich genug kommen könne, ihnen eine Vorstellung des ländlichen Sommers zu geben, war man darauf verfallen, im leeren, reinen Schönwetterhimmel auch die sturmverheißende Gewitterwolke schweben zu lassen, mit dem unbeweglichen Blitz im Leibe. Die Leute auf dem Bilde verrichteten nicht alle gemeinsam die gleiche Arbeit, sondern jeder ging einer anderen Beschäftigung nach. Wir Kinder sollten erkennen, wie mannigfaltig die Mühen des bäuerlichen Lebens seien, und darum also schnitt der eine Landmann mit sausender Sense das Korn, wendete es ein anderer mit der Gabel, band eine Frau Garben, und ein Holzfuhrwerk kam schwer beladen aus dem Walde hervor. Im Vordergrund aß ein Knecht, am Feldrain sitzend, aus einer Schüssel, und ein Mann schlief langausgestreckt im kreisrunden Schatten eines Apfelbaumes, der prangend voll war von gelben Früchten. Und ein kleines Mädchen im weißen Kopftuch betete knieend vor einem Wegkreuz. Es bete, das Gewitter fern zu halten, sagte man uns. Und wir glaubten auch gleich, das Wolkenlamm bliebe nur deswegen so klein über dem Dorfe stehen, weil das fromme Mädchen so inbrünstig mit gefalteten Händen es erflehte.
Das Bild war zwischen weiße Holzleisten gespannt, und als man es zum erstenmal, an einem grauen Wintertag, über die große, schwarze Wandtafel hängte, als sich der herrliche, gemalte Sommer in seiner Pracht vor unseren staunenden Blicken entrollte, da erfüllte er uns mit unbeschreiblichem Entzücken, und nach Schulbubenart riefen wir ein zwar echt empfundenes, aber doch auch absichtlich übertreibendes, langgezogenes »Ah!«, aus fünfzig Kehlen schallend, und der junge Lehrer im hohen Stehkragen zwirbelte seinen weißblonden Schnurrbart und lächelte gnädig über unsere Begeisterung.
Es war kein Kunstwerk, das uns so bezauberte und hinriß. Was einzig dem Maler geglückt war, oder was auch nur irgend ein Zufall bewirkt haben mochte, oder das noch mangelhafte Druckverfahren jener Zeit, das war die trockene, raschelnde, heiße Bräune, welche die Landschaft überzog. Das Korn war von bräunlichem, üppigem Gelb, in das Blau des Himmels war Gold gemischt, und ein weniges vom Braun und ein weniges vom hitzigen Golde steckte heimlich glühend in jeder der Farben auf dem Bilde. Und es war nur gut, daß die knisternde, verborgen schwelende Bräune sich an einem gemalten Blitz nicht zu entzünden vermochte, sonst wären das Dorf und die Felder vor unseren Augen prasselnd und Funken werfend in Flammen aufgegangen. Und wir hätten uns nicht gewundert darüber.
Der gemalte Sommer schien mir vollkommen schön, prangend in Fülle und Hitze, und der wirkliche blieb für meinen Sinn weit dahinter zurück. Wenn ich in den Ferien, bei ländlichen Verwandten, über die Felder ging, und den gleichmäßigen Bewegungen der Schnitter zusah, so sah ich keinen, der sich aus der Schar los löste, am Feldrain sitzend aus einer Schüssel die Suppe zu löffeln, und keinen, der müde genug war, um sich in den schwarzen Schatten eines Apfelbaums zum Schlaf zu strecken. War der Himmel auch zuweilen blau und goldflimmernd in seiner riesigen Leere, so spähte ich dann vergebens nach der Unheil verkündenden kleinen grauen Wolke aus. Und nie sah ich jemals im Leben ein kleines Mädchen mit gefalteten Händen knieend vor einem Wegkreuz beten.
Jetzt wird man das veraltete Sommergemälde von damals wohl nicht mehr im Anschauungsunterricht der Schulen verwenden, und man hat sicher längst ein Bild, das sich treu an die Wirklichkeit hält. Aber daß es den Sommer so heiß und raschelnd und geheimnisvoll glühend zu zeigen vermag wie jenes unserer Zeit, das irgendwo zwischen Speichergerümpel verstaubt, glaube ich nicht. Und fast auch will ich nicht glauben, daß die heutigen Tages viel klügeren und sachlicheren Schuljungen durch ein übertriebenes und ein wenig geziertes »Ah!« ihr Entzücken bekunden – aber das ist vielleicht nur Hochmut oder die Unfähigkeit des Gealterten, sich auch nur vorzustellen, daß der Glanz der Jugend unverblaßt bei anderen dauert.
Das bosnische Mahl
Das Tischtuch war aus grobfädigem, weißen Leinen, das Weiß war das Weiß eines von Tabakrauch gebräunten greisen Bartes, und getupft war es mit verblaßten, rötlichen Stellen, das war, weil das Tuch Rotwein geschluckt hatte, oft schon, im Lauf der Jahre. Da war es dann wohl betrunken gewesen und verrutscht und verknüllt, in der aufgelösten Verfassung Bezechter; jetzt lag es ordentlich und nüchtern gebreitet, aber auch die Rotweinspuren waren noch da, wie die Trinkerspuren in den Gesichtern der Menschen.
Durch das Fenster sah ich den Kastanienbaum, sah seine großlappigen Blätter, sah die rötlichen Blütenkerzen wie kleine Flämmchen leuchten und im Winde zittern, sah den blauen Himmel darüber, und den kalkweißen, spitz zulaufenden Turm der Moschee. Mit immer neuem vergnügtem Staunen betrachtete ich Baum und Turm, friedlich gesellt, weil ich bisher der Meinung gewesen war, nur mit christlichen Kirchen könne der Kerzentragende in Freundschaft leben, wie man das bei uns, in Bayern, oft antrifft: die Dorfkirche, von der weißen Friedhofsmauer umschmiegt, im Schatten des Laubgewaltigen, ein tief vertrautes Bild. Aber siehe da, man lernt nicht aus, sie vertrugen sich, Allahs Moschee und der Baum meiner Kindheit, und einen grünen Schimmer von dem Licht, das durch die gewölbte Krone fiel, hatte das grobfädige Tischtuch vor mir und hatte auch das kalkweiße Minarett.
Der Tisch war zum Essen gedeckt für mich, das Mahl mochte beginnen. Zuerst, natürlich, das ist Landessitte, und ich schloß mich nicht aus, ich tat es gern, wollte von dem Zwetschgenschnaps getrunken sein, dem Sliwowitz.
Es war ein junger Sliwowitz, vom vorigen Jahr, der weiß und wasserklar war – wenn er älter wird, glänzt er bernsteingelb. Ich goß mir ein Glas voll und leerte es auf einen Zug, die Eßlust zu reizen, die Begierde zu stacheln, gerüstet und vorbereitet zu sein für das nun zu Leistende. Der Sliwowitz begleitete das ganze Mahl, schob sich zwischen die einzelnen Gänge, und wie er den Anfang machte, machte er auch den Schluß. Ich wollte am Abend dann einen Lobgesang auf ihn dichten, ihm ein Preislied singen, ihn rühmen und verherrlichen, aber ich brachte es nur auf diese vier Zeilen:
Sliwowitz zuerst, den hellen,
Wasserweißen Zwetschgengeist,
Sanft und mild und doch von grellen
Funkenbündeln übereist!
Ja, so schmeckte der Schnaps, mild wie Milch, und wie mit Eisnadeln stechend und glühend zugleich. Das Mundtuch über die Kniee gebreitet, fester auf den Stuhl gesetzt, Gabel und Messer in die Hand, nun kam der erste Gang: Krainer Wurst in Teig gebacken. Krainer Wurst, rötlich dunkel, fett glänzend, hatte ich sie schon auf den Verkaufsbänken der Metzger in Laibach und Agram liegen sehen, vielfach gebündelt. In Scheiben geschnitten, mit krachender, brauner Teigkruste gepanzert, eröffnete sie mit einem kräftigen Klang, wie mit einem Paukenschlag, die Musik des Mahls.
Im tiefen Teller nun brachte der Aufwärter die Gemüsesuppe, ein Geschlinge und Gestrüpp und stachliges Gewirr von grünen Kräutern, von bläulichen, moosigen Geflechten, kleine gelbliche Zwiebeln schwimmend dazwischen, und schwärzliche Gurkenscheiben, und der geriebene Käse, reichlich darüber gestreut, leuchtete hell und trocken auf dem Gemüseberg wie Sommerschnee auf grünen Alpenwiesen. Mit List und Behutsamkeit wollte das Gericht gegessen sein, vom Löffel herab flatterten mutwillig die Fäden, die Zwiebeln suchten zu entwischen, und die Gurken brannten säuerlich im Gaumen.
Einen Sliwowitz dazwischen: jetzt kam der Hauptgang! Es war wie fast immer in Bosnien, Hammel, wie man das so sagt, so obenhin, fast verächtlich und naserümpfend: der unvermeidliche Hammel! Aber es war gar kein Hammel, nicht schwarzbraunes, zähes, starkriechendes Hammelfleisch, es war Lammfleisch, Lämmernes, weiß wie Hühnerfleisch, knusprig und locker auf dem weißen Knochen, die Haut hellbräunlich und rosa glänzend, wie ein Schimmer dünnen Glases, zart splitternd. Dazu gab es eine Schüssel grünen Salates: nicht schon angemacht, selber mußte man ihn schütteln und rütteln und wenden und mischen, und Salz dazu geben, und Essig und Öl, und geschnittene Zwiebeln in gerechten Teilen.
Es war ein kräftiges Stück, das ich auf dem Teller hatte, nicht nur so ein bißchen zum Naschen und Kosten, es war eine stramme, feste Mahlzeit, sich daran zu sättigen, daß ich schwer atmete, als ich den Teller leer hatte, und gierig nun war auf einen Sliwowitz, der die Lippen reinigte.
Ich lehnte mich behaglich in den Stuhl zurück, und sah zum blauen Himmel hinauf, der nun noch strahlender war – oder schien es mir nur so: –, sah in das lichte, grüne Gewoge der Baumkronen, tief innen wars dunkel dämmernd, und das kalkweiße Minarett schoß wie ein Pfeil nach oben, nach einem unbekannten Ziel: ihm war es bekannt, es wissen ja auch unsere Kirchtürme warum sie nach oben streben, zu den ziehenden Wolken.
So weit war das Mahl gediehen bis jetzt, zu meiner Lust, und neigte sich nun, verklingend, seinem Ende. Derb und bäurisch war es gewesen, aus einfachen und guten Gerichten bestehend, nichts Überspitztes, nichts Verfeinertes und Verschmitztes, keine ausgeklügelten Mischungen und seltenen Überraschungen, und so kam jetzt, ganz dazu passend, als Nachspeise Käse: eine kleine, bräunliche Kugel, es war Schafskäse, wie ihn die Hirten essen.
Das war ein Reiz besonderer Art, der sanfte, ländliche Käsegeschmack und darüber hin schwebend, hauchend, leise beizend, der Geruch des Rauches. Der bittere, schwarze Wein tränkte mich und so schmeckte mir das Hirtenmahl.
Im kupfernen Kännchen mit langem Stiel reichte man den Kaffee, auf türkische Weise zubereitet: das staubfeine Kaffeepulver schwimmt blasig obenauf, setzt sich langsam zu Boden, und was sich nicht setzt, das trinkt man mit. Zugleich mit dem Kaffee war eine kleine Schüssel Naschwerk gebracht worden, honigklebrige Würfel und Kugeln und Stangen aus gepreßten und gezuckerten Früchten, in brennenden Farben pfauig leuchtend, gelb und rot und blau, von einer übergrellen Süßigkeit, die fast schmerzend ist.
Der Krug schwarzen Weines war noch nicht leer, und im kleinen Krug blitzte noch feurig der Sliwowitz, und ich freute mich, kein Muselmann zu sein, dem Berauschendes zu trinken verboten ist, aber auch sie nehmen es nicht alle genau mit den Vorschriften, das hatte ich schon gemerkt.
Dazu rauchte ich selbstgedrehte Zigaretten, aus gelbem, langfädigen, würzigen Tabak und alles, was ich aß und trank und rauchte, war diesem Lande gemäß, das zwischen Morgen – und Abendland liegt, das vor einem Menschenalter noch türkisch gewesen war, von Begs und Paschas beherrscht, die dem gewaltigen Großherrn am Bosporus unterstanden, wo nebeneinander christliche Kirchen und Moscheen stehen, wo heute noch die Männer in Pluderhosen schreiten, langsam und feierlich, und den roten Fez auf dem Kopf tragen, und die Frauen sich verschleiern, wie die schon wankende Sitte es will – bald werden sie es nicht mehr tun!
So war das Mahl, im Schatten der Kastanie, im Angesicht der Moschee mit Hammel, Wein, Kaffee, gezuckertem Honig und Tabak, das bosnische Mahl in Banjaluka.
Die albanische Hühnerfahrt
Auf den Verkaufsbänken lagen die Hühner. Man hatte ihnen paarweise die Füße zusammengebunden, und schwer atmeten die fedrigen Bündel, die gläsern-flachen Augen unbeweglich offen. Aber der Hahn ist ein mutiges Tier, der Sporenträger, und die zwei jungen, aneinander-geknoteten Hähne peitschten plötzlich unruhig mit schimmernden Fittichen die Bank. Wie ein Wirbelwind war es, und es gelang ihnen auch, loszukommen. Sie schrien zornig, und schräg aufwärts flogen sie und schlugen sich die Flügelspitzen gegen die hochmütigen Gesichter. Eine kurze Weile schleppte der eine Hahn den anderen, der an seinen Füßen hing. Aber lange ging das nicht, sie überschlugen sich, drei, vier Meter hoch waren sie schon. Sie flatterten wild und fielen, im Fall sich immer wieder fangend, aber steigen konnten sie nicht mehr, sie stürzten dann doch in den Straßenstaub Skutaris. Zuckend blieben sie liegen und röchelten, als der lachende Bauer sie aufhob, hin und her schwang und die Betäubten dann auf die Bank warf zwischen die anderen Tiere.
Ich mag die Hühner nicht und scheue mich, sie anzurühren, und auch als Kind habe ich immer nur ungern eins auf den Arm genommen, wenn man es von mir verlangte, um mir die Zimperlichkeit abzugewöhnen. Den Hahn zu sehen in seiner Pracht, gefällt mir. Aber nichts lockt mich, ihn zu liebkosen: es ist eher Furcht, was ich vor ihm empfinde, wenn er einherstolziert, oder das Lachen kommt mich an! Und gerade mir nun sollte die Hühnerfahrt geschehen! Der Wagen, den ich bestellt hatte, war plötzlich da, und der Mann am Steuer, die Lammfellmütze schief gesetzt, zeigte grüßend seine blendendweißen Zahnreihen. Ich öffnete die Tür – das Gefährt war hoch angefüllt mit lebenden Hühnern! Aus gekniffenen Augen blickte der Fahrer auf den zögernden Gast, dann begriff er, und kam und lächelte ein wenig verächtlich und schaufelte mit beiden Händen die gackernden Tiere auf die Straße. Ich stieg ein, und so geschwind, wie er den Wagen geleert hatte, füllte er ihn wieder. Bis über die Knie hinauf von dem Federvieh umgeben, saß ich nun, und wir fuhren an der Moschee vorbei, vor der die grüne Fahne des Propheten wehte aus starrender Seide.
Angstvoll blickte ich auf die Hühner und wagte nicht mich zu rühren, keinem Huhn weh zu tun. Mit dem Rücken preßte ich mich haltsuchend an die Wand und stemmte die Füße verzweifelt gegen den Boden: so saß ich nicht eigentlich, ich hing, wie der Felskletterer im Kamin eingestemmt hängt. Der Hühnerberg war in unaufhörlicher Bewegung. Die Tiere hielten nicht Frieden, sie zankten sich und schlugen mit den Schnäbeln aufeinander ein, und wenn der Wagen eine Kurve nahm, stieg mir der Berg bis an die Brust.
Es ging durch den Basar. Rötlich blitzte es aus den Verschlägen der Kupferschmiede. Vor den Buden der Fischhändler glänzten silberne Fische. Dunkelrote Hammelhälften, von schwarzen Fliegen bedeckt, hingen an den Haken der Metzger. Goldbesetzte Kleider wehten von den Stangen, Sättel lagen da, und Säbel, und Gelächter und Geschrei hob sich zu mir herein. Schmutz und Gold, so war es zu sehen, im uralten Gegenspiel. Ein scharfer Geruch von Hammelfett und Pferdemist beizte die Nase, und ein Windstoß roch nach Wasser und Schlamm vom Skutarisee.
Nun kam die Landstraße. Die Gegend war flach und sumpfig, baumlos. Schwarze Wasserbüffel, bis zur Brust im Schlamm, drehten schwer ihre Köpfe her, und ein hoher, dunstiger Himmel wölbte sich. An einem schilfumgürteten Weiher fuhren wir vorbei, Wassergeflügel schwang sich auf vor dem Lärm unseres Wagens, und eine strohgedeckte Fischerhütte stand am Ufer, traurig und einsam. Die Fische in dem montenegrinischen Rijeka gestern kamen mir in den Sinn. Den breitnackigen, fetten Tieren hatte man durch die gelblichweißen Mäuler Weidenruten gezogen, und die Ruten endeten in einer zierlichen Schleife, daran man sie nach Hause trug. Auf den nassen Steintischen hatten sie gelegen, ohne sich zu rühren, und hatten vergeblich und quälend, auf und zu und auf und zu, Feuriges einatmend, die Mäuler geöffnet und geschlossen.
Die Knie taten schon weh, so unbeweglich, wie ich sie halten mußte. Vorsichtig schob ich den einen Fuß vorwärts, den anderen dann und rückte mich ein wenig zurecht. Ein großes, weißes Huhn, das zu oberst lag, starrte mich mit bösen Augen an. Die Tiere plusterten sich, und nur selten erscholl ein kurzes Gackern. Ich blickte nach vorn auf die Straße, die uns weiß entgegenlief. Eine Schlange, gut einen Meter lang und fast armdick, nahte sich in schnellen, blau blitzenden Windungen. Sie wollte noch vor uns über die Straße. Aber der Wagen war schneller, er überfuhr sie, die es so eilig hatte zu sterben. Ich spürte, wie die Räder über sie hinweggingen, und duckte mich im Augenblick der Hinrichtung. Als ich zurücksah, waren es drei Schlangen, die im Staub sich krümmten, und eine bäumte sich steil auf.
Die Sonne hatte den Dunst zerstreut, helles Licht lag über dem alten Land der Skipetaren – so nennen die Albaner sich. Beklemmend war die dumpfige Hitze der Tierleiber zu atmen. Ich hätte gern geraucht, aber als mich eben wieder ein Blick des weißen Huhnes traf, unterließ ich es. Zu meinen Füßen begannen zwei Hühner zu raufen. Ein zorniges Röcheln drang von unten her aus dem Berg, und da wurden auch die anderen Hühner unruhig, ein Flügelschlagen hob an, rauhes Ächzen tönte, der Hühnerberg bebte wie ein Vulkan vor dem Ausbruch. Aber der Ausbruch kam nicht, es wurde wieder geisterhaft still.
Dann war es: über die braunen Sumpfwiesen her kam ein Reitertrupp, nicht regelmäßig aufgeschlossen, aufgelöst wie ein Vogelschwarm. Es waren zierliche, kleine Pferde mit lang wehenden Schweifen, die Reiter trugen goldbesetzte, kurze Jacken, im purpurnen Gürtel den Dolch, manche ein Gewehr über der Schulter. Die Hosen waren weiß, rot die
Stiefel, eng anliegend ihre Schäfte, aus weichem Leder, wie Handschuhleder sich fältelnd. Sie mochten zu einem Fest reiten, einer Hochzeit, an der Spitze auf einem Rappen ein junger Mann, fast ein Knabe noch, vornehmen Geblüts, so gab er sich. Sie querten vor uns die Straße, und der Fahrer hielt demütig, sie vorbeizulassen. Sie hatten verschlossene Gesichter, wir waren für sie gar nicht da, keiner schenkte uns auch nur einen schnellen Blick. In kurzen Sprüngen setzten sie vorbei, katzenhaft, ein großes Blitzen war, erschrocken-wilde Pferdeaugen, weißer Schaum auf Pferdeschenkeln, sommerlicher Schnee! Ein Apfelschimmel bäumte sich, einmal, zweimal, aber der Graubart, der ihn ritt, hatte ihn rasch wieder gebändigt und trieb ihn, der noch unruhig tänzelte, den Gefährten nach, die ins offene Feld hinaus sich entfernten.
Der mit der Lammfellmütze am Steuer blickte sich nach mir um, erhaben glänzte sein Gesicht, so hatte das Bild der Reiter ihn erregt. Dann deutete er mit der ausgestreckten Hand, an der ein schwerer, goldener Ring türkischer Arbeit saß, nach vorn: aus der Ebene hob sich, noch weit von uns, ein spitzes Minarett. Das mußte Alessio sein, mein Ziel! Der Himmel war jetzt tiefblau. Ich versuchte das mürrische, weiße Huhn zu streicheln, aber es litt es nicht und hackte boshaft nach meiner Hand – wir waren nicht Freunde geworden!
Vor vielen Jahren war das, und Albanien war dem König Achmed Zogu untertan, widerwillig. Die Bergfürsten gehorchten ihm nicht. Achmed Zogu lebt jetzt in der Verbannung, und die östlichen Machthaber gebieten von fern her über das stolze, kleine Land. Die Blutrache gilt dort noch. Alexander der Große, rühmen die Albaner sich, sei einer der ihren gewesen! Niemand weiß es genau, es ist schon zu lange her.
Die sizilianische Vesper
Heinrich Ströbl war sein Name. Wir sagten: der Ströbl Heinerl. Er war für sein Alter, für seine fast sechzehn Jahre, schon groß, auch schon recht dick, mit einem runden, gutmütigen Gesicht und weißen, fettgepolsterten Händen. Seine Fingernägel waren immer sorgfältig geschnitten und gefeilt. Er machte auch sonst einen gepflegten Eindruck und trug gute und gut gebügelte Anzüge. Beinahe schon ein Herr. In der Schule war es ein Jammer mit ihm. Sein runder Kopf mochte nichts behalten, und was er dann doch behielt, verwechselte er. Ströbl war guter Leute Kind, drum mußte er die höhere Schule besuchen, zu seinem Entsetzen und zu dem der Lehrer, da half nichts.
Im Geschichtsunterricht hatten wir es auch mit den Kreuzzügen zu tun. Neben den großen, entscheidenden Tatsachen, neben den Jahreszahlen von Schlachten und Friedensschlüssen sich bezeichnende und farbige Einzelheiten zu merken, das verlangte unser Lehrer. Die prägten sich leicht und für immer ein, sagte er, und sie seien, was der Maler mit dem Fachausdruck »ein Licht aufsetzen« nennt. Die Kreuzfahrer zogen mit dem Rufe »Gott mit uns!« ins Feld gegen die Heiden und Sarazenen, so lernten wir. Er las uns, der Geschichtslehrer, als hierher gehörig die »Schwäbische Kunde« von Ludwig Uhland vor, in der geschildert wird, wie der fromme Ritter mit einem Schwertstreich einen Gegner von oben bis unten spaltet: »Zur Rechten sah man wie zur Linken einen halben Türken hinuntersinken« das machte Eindruck auf uns, wahrhaftig unvergeßlich, ein Glanzlicht! Und von der Sizilianischen Vesper hörten wir. An einem stillen Abend wars, zur Vesperzeit, als die heißblütigen Sizilianer, die gegen die französischen Eindringlinge sich erhoben hatten, jeden armen Kriegssoldaten des fremden Landes töteten, dessen sie habhaft werden konnten. Und der Geschichtslehrer wußte wieder ein Glanzlicht auf dem Entsetzensbild anzubringen: Um einen Feind, der sich etwa verkleidet hatte, dem Strafgericht zu entkommen, nicht entwischen zu lassen, verlangten die Aufrührer in jedem zweifelhaften Fall von dem Manne, er solle sagen: cece, cici, ciceri! (Gesprochen wird es: Tschetsche, tschitschi, tschitscheri.) Das nun brachte keiner Mutter Sohn richtig heraus, der in Paris geboren war oder Bordeaux oder sonstwo im gallischen Land, und der Feind war erkannt, und grausam wurde er niedergemetzelt.
Sie hat, diese Kriegslist, schon einen Vorläufer in der Bibel. Der Geschichtslehrer wußte es vielleicht nicht, jedenfalls sagte er es uns nicht. In der Bibel wird erzählt, daß die Gileaditer, die im Kampf lagen mit den Ephraimitern, diese, wenn sie sich versteckt hatten, und ertappt dann harmlos und freundlich taten, das Wort »Schiboleth« sprechen ließen. Die Armen sagten: Siboleth. Das »sch« gelang ihnen nicht, und das war ihr Tod. So wiederholt sich alles.
Um wieder vom Ströbl Heinerl zu reden, dem Guten, so sahs in dessen Kopf wüst genug aus. Die einprägsamen Einzelzüge und Glanzlichter brachte er durcheinander wie Kraut und Rüben, heillos, es mochte ihm wohl manchmal schwindeln. Aber was er sich dann einmal leistete, schlug dem Faß den Boden aus und war der Anfang vom Ende seiner Schullaufbahn. Als er sie dem Gehege seiner Zähne entlassen hatte, die unglückselige Antwort, und wir uns minutenlang aufführten wie die Indianer, tanzend um den Marterpfahl, und er, der Heinerl, war am Pfahl, wurde sein rotes Gesicht weiß, und das blasse des Lehrers wurde ganz rot, wie Mohn, rot wie ein Hahnenkamm. Ein paar Wochen drauf verließ der Heinerl die Schule, mitten im Jahr, es war nicht mehr zu machen, und trat in das väterliche Geschäft ein, in der kleinen Landstadt, droben im Wald. Ob er ihn zugrunde richtete, den väterlichen Lederhandel, weiß ich nicht zu sagen. Ich verlor ihn aus den Augen, ganz und gar, und sah ihn niemals wieder. Aber Leder ist zäh und dauerhaft und möglicherweise ging alles gut ab. Aber damals, als ihn der Lehrer fragte, wie der Schlachtruf der Kreuzfahrer gelautet habe, wenn sie auf die Heiden einstürmten, und die Fahne wehte ihnen voran, da hatte der Ströbl Heinerl zuerst noch aufmerksam seine glänzenden Fingernägel betrachtet, als würde ihm von ihnen Rat. Aus voller Brust dann und siegesgewiß, mit seiner Stimme, die schon fest und dunkel war, ein Baß, während unsere oft noch kreischte wie eine Säge im Holz, und nur hie und da schon voll tönte wie eines Mannes Stimme, hatte er gesagt: Tschetsche, tschitschi, tschitscheri! Wie Posaunenhall hatte er seine Antwort hingeschmettert. Er hatte es mit der sizilianischen Vesper verwechselt. Sein Kopf verwechselte so leicht alles, wie schon ein paarmal gesagt; so war er nun eben.
Werft keinen Stein auf ihn! Wir waren unbarmherzig und warfen viele Steine auf ihn, und begrüßten ihn jeden Morgen mit einem schallenden Tschetsche! Er ging dann also bald von der Schule ab, recht tat er daran, für die Wissenschaft war er nicht geboren. Er trat in die Schule des Lebens ein, in den Lederhandel. Fast nehme ich an, er wird Kalbsleder nicht mit Rindsleder verwechselt haben. Schließlich, was wissen wir schon, ich und du? Bedenks! Und das Lachen wird dir vergehen!
Der Grasgarten
Kneiting heißt das Dorf, und im späten Sommer ist es schön dort. Es gibt einen Grasgarten dort, der ist nicht zu vergessen. Langes grünes Gras und krumme Stämme der Zwetschgenbäume, das ist der Garten, und er hat keinen Zaun. Kneiting hat auch eine alte, weißgekalkte Kirche und ein Pfarrhaus und eine Handvoll Bauernhöfe und Wirtshäuser. In die Außenwand der Kirche ist, aus rostrotem Stein, eine Grabplatte eingelassen. Sie stellt, in Lebensgröße, einen vogelnasigen Ritter dar, der voll geharnischt ist, eine Streitaxt in der Rechten. Ich denke immer nur an den Grasgarten, wenn ich an Kneiting denke. Es ist ein kühles, grünumlaubtes Dorf mit alten, ungeheuren Nußbäumen, es ist ein Schattendorf, und weil Kneiting auf einer der Sonne preisgegebenen Anhöhe liegt, ist es kein feuchter, ist es ein wohltuender, kühltrockener Schatten.
Kurze Zeit einmal, einen kurzen Sommer lang, hauste ein seltener Vogel in Kneiting, Josef, ein Maler. Der war zu seinem Vater gezogen, der Bahnangestellter war, Streckenwärter oder so etwas, oder etwas Höheres, aber nichts Hohes. Kneiting, übrigens, wird von der Bahn nicht berührt, aber der Streckenwärter, oder was er war, wohnte dort, halb bäuerlich, mit einer Kuh im Stall und Huhn und Hahn. Der Maler, sein Sohn, hatte sich in einem alten, baufälligen Stadel am Ortsrand eingenistet, mit Büchern, einem grellbunten, wurmzernagten Bauernschrank, von dem die Farbe blätterte, einem hölzernen Barockengel, mit vergoldeten Flügeln und großen blauen Augen – ganz künstlerisch sah es im Stadel jetzt aus, mit den vielen herumstehenden Bildern, von dem blauäugigen Engel bewacht, und abends spielte er im Wirtshaus Karten mit dem Pfarrer und dem Lehrer.
Es gab Leute, die ihm, das ist nicht gelogen, hin und wieder einmal ein Bild oder auch nur eine Zeichnung abkauften, um geringes Geld, versteht sich – er war jung und voll von Hoffnungen der Jugend, und es war ein glückliches Leben, nehmt alles nur in allem, und zu einer Pfeife Tabak reichte es auch, und zu malen gab es genug, zu landschaften.
Kneiting hatte auch, und hat wohl noch, den kropfigen Hans, einen Burschen unbestimmbaren Alters mit tränenden Augen im törichten Gesicht. Er trug am Hals einen überquellend großen, rot glänzenden Kropf, der es ihm verwehrte, je den Hemdkragen zuzuknöpfen, so mächtig war der Kehlsack. Schön war er nicht, Hans, der Kropfige, aber er wußte es nicht, und jedenfalls litt er nicht darunter: selbstbewußt kam er daher, in der Pracht seiner Halszier, mit jedem Truthahn wetteifernd. Er half bei den Bauern aus, zu leichten Arbeiten, schweren ging er aus dem Weg, meist streunte er herum. Zu essen hatte er auch aus der väterlichen Schüssel, darin glich er dem Maler.
Dorfdepp – das hat man in Bayern, in Schwaben oft, fast jedes Dorf hat einen, er braucht nicht immer einen Kropf zu haben – ein Depp gerade war er nicht, der unschöne Hans, das wäre zuviel gesagt. Er konnte mit schwerer Zunge, kollernd wie ein Truthahn, auch das kam vom Kropf, Erstaunliches von sich geben, Galle und Weisheit mischend, weiß keiner, woher ers hatte, und einen dabei aus tränenden Augen starr anblicken, zum Eingeschüchtertwerden schier oder auch zum Lachen. Den Mädchen aber schauderte es.
Nun streunte nicht bloß mehr der kropfige Hans umher in Kneiting und tauchte auf, wo man ihn nicht erwartete, auch der Maler. Der kropfige Hans gehörte zum Dorf, er war eingeordnet und von jeher da, ein Hiesiger, Kneiting wäre nicht Kneiting gewesen ohne ihn, schwieriger wars mit dem Maler – was sollte man von ihm halten? Sein Vater hatte eine nützliche und geldeinbringende Beschäftigung, von daher fiel ein günstiges Licht auf den Sohn. Der war, in den Augen des Dorfes, nicht ein Maler, sondern der Sohn des Streckenwärters. Und wer kann für mißratene, aus der Art geschlagene Söhne? Der Vater des Kropfigen konnte ja auch nichts für dessen stets offenen Hemdkragen und die tränenden Augen! Der Maler überdies spielte sogar Tarock mit dem geistlichen Herrn und dem Schullehrer, so mußte es schon auf irgend eine Weise der rechte Gang mit ihm sein, dachte man. Was wissen wir Bauern?
So nahm man duldsam die beiden Väter hin und die beiden Söhne. Als der Maler das Dorf wieder verließ, im frühen Winter, mit dem Schrank und dem blauäugigen Engel auf dem Karren, den die Kuh des Vaters zur Bahn zog, ward er zum letztenmal und nie wieder gesehen in Kneiting. Den Kropfigen sah man auch forthin täglich. Ihn hätte man vermißt, den Maler vermißte niemand.
Der junge Maler, als er noch da war; malte ganz merkwürdig, mit so schnellen Tupfen, und recht durcheinander, man konnte nie genau erkennen, was er malte, wenn man ihm zusah, die Heugabel über der Schulter. Die Bauern sagten auch nichts von seinen Bildern. Nichts Gutes und nichts Schlechtes. Nur der kropfige Hans sagte einmal etwas. Er sagte, was die Bauern sich dachten.
Des Streckenwärters Sohn malte an einem schönen Tag den Grasgarten. Ich sah das Bild später und möchte es gern besitzen: ein Langformat, anderthalb Hände hoch, fünf Hände breit. Ach, der stille Grasgarten von Kneiting ist auf dem Bild, das ganze Schattendorf, die Sonne, die nicht hineinkann, alles. Das malt man so nur, nicht bloß, weil man begabt ist, und in der Gunst einer glücklichen Stunde, da muß noch etwas anderes dazugekommen sein, ein geheimes Einverständnis zwischen dem Maler und dem Grasgarten: ich denke, der Grasgarten wollte gemalt sein, so und nicht anders.
Das Bild war ungefähr fertig, da stand der kropfige Hans hinter dem Maler und seiner Staffelei. »Grüß dich!« sagte der Sohn des Streckenwärters, »grüß dich, Vieledler!« und malte emsig weiter, kniff ein Auge zu, trat einen Schritt zurück, um wieder einen Pinselstrich zu setzen, wie die Maler das so machen, und hatte den Kropfigen schon fast vergessen. Lang und lange das Bild betrachtend, stand der, mit gerunzelter Stirn. Und zuckte hochmütig mit der Schulter und sagte mit seiner kollernden Stimme: »Schön heut, hörst?« – denn der Ostwind trug einen Pfiff von der Bahn herüber, und den Pfiff hörte man in Kneiting gerne, weil er gutes Wetter bedeutete. »Josef«, sagte er dann, wie immer noch dem Pfiff lauschend, »Josef, hat dich dein Vater nicht bei der Bahn unterbringen können?« Da pfiff es wieder, und er ging, mit gekrauster Nase, schaukelnd wie ein gereizter Truthahn, ins Dorf hinein und ließ den Maler zurück, der laut lachte und fortfuhr, an dem Bild zu malen. Bis ihn doch eine kleine Traurigkeit überkam und er den Pinsel sinken ließ, weil es ihm nicht möglich gewesen war, das, was er vom Grasgarten herüberfließen fühlte, weiterzugeben, jeden zu erquicken. Dann arbeitete er fort, und die kleine Traurigkeit kam auch zu dem Bild hinzu und machte es gut und fertig.
Ach, Hans, kropfiger Hans, boshafter Truthahn! Blaurötlich hängen im Herbst die Zwetschgen an den Bäumen des Grasgartens und warten darauf, gepflückt zu werden, und immer noch schwingt der vogelnasige Ritter an der Kirchenwand die Streitaxt. »Der war, ich glaube, ein Schöntuer«, sagte mir später der Maler, »er hat so das Gesicht und tat einer Kneitinger Magd schön zu seiner Zeit. Und seine vornehme Ritternase sitzt nun dem kropfigen Hans im Gesicht. Ist Ihnen das nicht auch aufgefallen? Man muß immer seine Augen offen halten: Nur der Schein trügt nicht.«
Klage eines weißen Mannes
Als Vierzehnjähriger schwärmte ich für die Indianer mit einer feurigen Hingabe, über die ich auch heute nicht lächeln kann. Ich schuf mir in ihnen Wesen einer höheren Art, edler und von mehr Größe als die Männer um mich, deren Gewöhnlichkeit zu durchschauen mir nicht schwerfallen konnte. Das rothäutige Geschlecht, mit den fließenden Wassern, den ziehenden Wolken und mit Baum und Tier brüderlich vertraut, galt mir höchster Verehrung würdig. Ich träumte davon, zwischen Häuptlingen über die dunkelnde Steppe in den Abend zu reiten, und unser Hufschlag dröhnte auf der Erde. Ich saß unter überhängenden Felsen am Lagerfeuer, während eintönig der Regen niederrauschte. Über wogenden Büffelherden zuckten unsre Lassos und zwangen den schnaubenden Stier in die Knie. Beim Morgengrauen durchschwammen wir blaufunkelnde Flüsse, und der hohe Mittag fand uns auf der Fährte des Felsenpumas. Die Sonne dörrte uns, und der Regen wusch uns, und der Wind kam gefahren und trocknete unsere nassen Haare. Und selbst das noch: am Marterpfahl zu stehen, pfeilumschwirrt, und in Kriegsgesängen die Feinde höhnen, schien mir ein beneidenswertes Los. Ich liebte die roten Männer, und die Tränen, die ich vergoß, nicht als Sioux geboren zu sein, waren bitterer als jene, die ich weinte, als mich das erste falsche Mädchen verriet, um mit wehenden Zöpfen dem treulos lachenden Freund sich zu gesellen.
Die Sehnsucht nach dem erdnäheren Dasein der Waldleute verflüchtigte sich, als ich mit zwanzig Jahren durch die breiten Straßen der Großstadt ging, über denen Bogenlampen wie falsche Monde prahlten. Die großen Worte glattrasierter Männer auf der Bühne ließen mich erbeben, es verwirrte mich das Lächeln auf den geschminkten Lippen der Schauspielerinnen, und das Rasseln der Hochbahn klang mir gewaltiger als der Donner der Berggewitter. Ich bin nicht lange vor diesen Wundern auf gläubigen Knien gelegen. Doch als ich erkannte, daß die sieben Farben des Regenbogens glühender und milder brennen als alle Schmelzöfen der Länder, war mir die Natur nur mehr ein Schauspiel, das ich mit bewundernden und ungerührten Augen genoß.
Wenn ich heute taub und blind durch den Wald gehe und vor dem Schrei des Hähers und dem Rascheln des Eichhörnchens zusammenfahre, bin ich traurig bei dem Gedanken, daß Wald und Wolke und Fluß mir fremd wie fremde Sachen sind, und mir im Blut bekannt sein könnten wie der Schlag meines Herzens. Die Säfte, die der Pferde glänzende Schenkel prall machen, die Flügel der Vögel heben und in den Bäumen brausend nach oben rinnen, müssen notwendig und innig denen verwandt sein, die durch mich rinnen. Daß ich diese Verwandtschaft nur mit dem Verstande begreife, sie nicht mit Herz und Blut liebend fühle, ist ein Schmerz, der mich nicht verläßt.
Ich habe viel in Indianerbüchern gelesen: wie waren sie schön und aufregend in ihren bunten Umschlägen! Als mir zum erstenmal ein Band mit Schillers Gedichten in die Hand kam, gleich fand ich, als ich ihn aufschlug, den Gesang vom Tod des Häuptlings und las ihn wieder und wieder. Die Verse beginnen, ich gebe sie aus dem Gedächtnis wieder, ungefähr so:
Seht, da sitzt er auf der Matte,
Aufrecht sitzt er da,
Mit dem Anstand, den er hatte,
Da er’s Licht noch sah.
Der große, rote Greis stirbt, aber ihn schüttelt kein schmerzlicher Krampf, und splitternd bersten bei ihm keine bösen Stricke, die uns an die kalte Klippe Erde schnüren. Die kristallene Luft um ihn ist wie ein gewaltiger, blitzender Wassertropfen, in dessen Mitte er schwebt, von dem er aufgesogen wird. Lächelnd vergeht er, wie die Blume im Herbst erlöst zerfällt. Über den Bergen, im Blauen, liegt Manitou, der Herr des Himmels und der Erde, ein riesiger roter Krieger, und stößt tanzende Wolken aus seiner Pfeife. Er wird neben ihn sich strecken, und Frühling und Herbst und alle Jahreszeiten werden wie Schatten über die Täler wehen.
Ich möchte sterben wie er. Aber wir müssen einmal fliehen von der Erde, die uns eine fremde Insel war, und zitternd, vom Fremden zum Fremden, stehlen wir uns fort. Von einer Woge stechender Disteln, die uns unwillig trug, heben wir uns in ein Boot, zur Fahrt über ein Meer, vor dessen Erahnen uns schon der Hauch vor dem Munde gerinnt.
Die Taubenfedern
Der mit dem blondglänzenden Haarschopf zielte auf mich. Sein Bogen war aus einer grünen Weidenrute, der Pfeil, ohne Spitze, war ein Stück Schilfrohr. Der Schütze sah mich streng an: »Halt!« sagte er, »oder ich schieße!« Sein dunkler Freund, stupsnäsig, mit aufgeworfenen, sehr roten Lippen, zückte ein Holzmesser.
Der Platz, zur Straßenseite offen, war von Mietshäusern eingerahmt, an einer Stelle war der Rahmen beschädigt – da stand eine in sich zusammengesunkene Ruine. Der Platz war mit spärlichem Gras bewachsen und von zerbrochenen Ziegelsteinen rot gefleckt. Ein Fußpfad schlängelte sich zur Ruine. Löwenzahn stand in unordentlichen Büscheln herum, blau war der Himmel. Auch ein paar Disteln waren da und sonst krautiges Zeug.
Der Bogenschütze hatte sein Haar mit Federn geschmückt, und sein Freund trug Federn in der linken Hand, die er zur Faust geschlossen hatte. »Großer Häuptling«, sagte ich zu dem Bogenschützen, »ich ergebe mich«, und hob die Arme. Die Stupsnase aber sagte verweisend: »Ich bin der Häuptling! Der da ist nur ein Krieger meines Stammes«.
Der Bogenschütze sagte: »So ist es!« und ließ die Waffe in einer edlen Bewegung sinken. »Wir werden dich nicht martern«, sagte er, »hab nur keine Angst!«
Jetzt tröstete mich auch der dunkle Häuptling: »Sei ruhig«, sagte er, »wir spielen ja nur Indianer!«
»Seht doch!« sagte ich, »den vielen Löwenzahn!
Das Wort kannten sie nicht, und der Bogenschütze fragte; »Du meinst die gelben Blumen?«
»Ja, die!« sagte ich, »habt ihr den Namen nicht in der Schule gehört?«
»Kann schon sein«, sagte der Dunkle verlegen und nagte mit den Zähnen an der Oberlippe. Dann öffnete er die Faust, mir seine Federn zu zeigen. Sie schillerten blaugrün und waren verdrückt von seinem Griff.
»Von einem Adler?« vermutete ich.
Verächtlich schüttelte der Bogenschütze den Kopf »Nein, es sind Taubenfedern!«
Eben schwang sich eine Taube über uns hinweg auf ein Hausdach, und eine zweite folgte ihr. Sie putzten sich das Gefieder und äugten neugierig zu uns herab. »Der Adler«, sagte ich, »ist der König der Vögel, und holt sich manchmal kleine Kinder, wenn er hungrig ist. Es kommt ihm garnicht darauf an!«
»Adler gibt es bei uns nicht«, sagte der Bogenschütze ablehnend.
»Doch«, beharrte ich, »gibt es, im Tierpark!«
»Da sind sie aber hinter Gittern«, sagte der Bogenschütze, »und können nichts machen!«
»Und die Löwen auch nicht«, sagte der Häuptling, und setzte einen Fuß auf den Löwenzahn.
»Eure Federn sind schön«, lobte ich.
»Willst du ein paar haben?« forschte der Dunkle aufgeregt. »Da hinten liegt eine Taube, von der haben wir sie. Aber es sind noch mehr dran.«
Sie führten mich zur Ruine. In einem Winkel, bei verrosteten Blechbüchsen, bei Flaschen, neben einem Steinhaufen, der mit Brennesseln bewachsen war, lag eine tote Taube, halb gerupft. Es kletterten Ameisen auf ihr herum.
»Nimm dir ein paar Federn!« ermunterte mich der Häuptling. »Oder traust du dich nicht? Ich will es für dich tun«, und er bückte sich schon.
»Vielen Dank auch«, wehrte ich ab, »nein, was täte ich damit?«
»Du könntest sie dir an den Hut stecken«, schlug der Häuptling vor. »Mein Vater hat auch Federn am Hut. Bei dem sinds aber Auerhahnfedern, die sind teuer.«
Von der Taubenleiche stieg ein dünner Geruch auf. Eine große weiße Wolke war jetzt am Himmel zu sehen, dickbäuchig schwamm sie dahin, wie ein Walfisch. Wildes Gestrüpp hatte sich in den Trümmern der Ruine angesiedelt. »Ali, Ali!« rief da eine Frauenstimme, »Ali komm!«
Der Bogenschütze sagte: »Meine Mutter«, und sagte: »Auf Wiedersehen!« und rannte davon. Den Bogen hatte er geschultert, den Rohrpfeil hatte er in der Hand. Die Federn in seinem Haar schwankten im Laufwind, und eine verlor er. Die schaukelte langsam zu Boden.
»Ali«, fragte ich, »wohl gar ein Türke?«
Das verstand der Dunkle nicht. Er sagte: »Alexander heißt er.«
»Kein hübscher Anblick«, sagte ich, »die Taube.« Sie lag schrecklich still bei den Flaschen.
Der Häuptling faßte sie bei den starr gekrümmten Zehen und warf sie mit schönem Schwung und gut gezielt durch eine Öffnung in den Keller der Ruine. »Da fressen sie die Ratten«, sagte er ohne Schaudern.
Ich pflückte einen Löwenzahn, weiß trat die Milch aus der Bruchstelle des Stengels. »Ich war in dem Haus drin, als es gebombt wurde«, vertraute er mir an, und er hatte jetzt das Gesicht eines Erwachsenen. »Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern«, sagte er. Sein dunkelroter Mund glühte wie eine Pfingstrose. »Damals war ich ja noch so klein«, sagte er. Er zeigte es mir, indem er die Hände nah gegeneinanderhielt.
Der große weiße Walfisch am Himmel hatte Junge bekommen, drei der kleinen Wolkentiere schwammen übermütig neben der Mutter her. Von einer nahen Kirche läutete die Mittagsglocke, fromm und friedlich. »Servus«, sagte ich, »ich muß jetzt gehen!«
Der Häuptling steckte sein Holzmesser in den Hosenbund, damit er die höfliche, rechte Hand frei habe, und reichte sie mir mit einer kleinen Verbeugung. Das Holzmesser war mit Silberpapier überzogen, daß es echt und metallisch aussehe. Die Taubenfedern hielt er fest in der linken Faust. Es waren zwei wohlerzogene Kinder.
Tausend Rehe
Wenn es des Dichters Recht ist und sein Stolz und seine Stärke, im Wort gewaltig auszuschweifen, um, was er fühlte, sah, und was um ihn geschah, im erhöhten Bild anschaulich hervorzutreiben, dann steht das auch dem Manne zu, der am Stammtisch erzählt. Von Jägern ists bekannt, daß der Bock, den sie erlegten, groß und schwer war wie ein Kalb, und halsbrecherisch unzugänglich die Felsschlucht, in der sie ihn vors Gewehr bekamen, und sein Gehörn war schön und weißrötlich zugespitzt wie die Brust der Sulamith: man heißt es Jägerlatein! Armlang, zum mindesten, war der Hecht, den der Fischer aus dem Wasser zog – er schwört es dir bei allen Heiligen! Als er ihn aus der schwarzen Flut hob, aus dem weißen Wasserschwall, den er tobend aufwarf, der Furchtbare, war er armlang – glaubs! und sag: Petri Heil! Wenn die Frau zu Haus ihn mit Kräutern und Zwiebeln dann siedet, und er kommt auf den Tisch, die friedliche grüne Petersilie im scharfzahnigen Räubermaul, da ist er kleiner, viel kleiner auf einmal … wie das nur zugeht? Und der Fischer, die Beute vor sich auf der Silberplatte, kennt sie kaum wieder, und spürt sie noch an der Angelschnur reißen mit des Haifisches Kraft.
Wie der Liebende die Braut sieht, mit Rosenwangen, schwarz glänzend das Haar wie Rabengefieder, und ihr Gang ist wie eines Rehes Gang, und ihre Stimme nachtigallisch: nicht jeder hört und sieht sie so, nur der Verzauberte schwärmt und übertreibt. Dieser hier war ein Händler seines Zeichens, Eiergroßhändler, Franz mit Vornamen was soll sein genauer Name? Ich laß ihn weg. Was wissen wir von Homer? Gerade noch den Namen, und ob er gelebt hat, bleibt strittig. Sein Gesang aber schallt durch die Jahrtausende, in ewiger Jugend, und er übertrieb auch im Wort, unbekümmert und löwenmäßig, der Vater der Dichter. Franz war Eierhändler – welch ein Beruf! Die weißenglänzenden Dinger, riesigen Perlen gleich, in Kisten und aber Kisten, die zerbrechlichen Früchte der Hühner – ein winterlicher Anblick, Hügel hinter Hügel! Er, Franz, war ein ausnehmender Freund des Weines, und am liebsten trank er den roten, er, der mit Weißem handelte: weiße Eier, roter Wein, das ist, wie Schneewittchens Wangen sind, und zeugt schön für den Mann und sein dichterisch Gemüt! Er war der unermüdliche Rotweintrinker nicht nur, er war der große Erzähler des Stammtisches, und oft hatte er, wenn, der Geist in ihm wehte, die goldene Harfe geschlagen und hatte sein süßmundig Lied uns getönt.
Der Sonntag heute war heiß gewesen, atlasweiß und seidenblau, und er war mit seinem Freund, den er nun zum Tisch mitgebracht hatte, den lieben, langen Nachmittag im grünen Wald gewesen – voll war er noch von all der Pracht! Der Wald hatte gerauscht wie eine Kirchenorgel, die roten Fliegenpilze hatten gebrannt, wie Zauberlaternen im dunklen Moos aufgestellt, Brombeeren hatten sie gepflückt, groß wie Taubeneier, aber schwarz natürlich, glühend und dampfend und Feuerkugeln werfend war die Sonne hinabgesunken, und als die Dämmerung kam, waren die Rehe scheu und zögernd auf die Wiesen hinausgetreten, zu äsen. Er beschrieb es, und der mitgebrachte Freund nickte zustimmend. Da und dort, und immer wieder, nach jeder Wegbiegung, wenn eine neue Wiesenfläche sich darbot, zeigten sich die Tiere, zierlich, wie aus Glas, und der Wald voll Wipfelrauschen, und es duftete wie aus Salbenbüchsen.
Ein verspäteter Mann der Runde kam und setzte sich und hörte, wie Franz schwärmend die Harfe schlug, und fragte: »Was erzählst du?« »Ach!« sagte Franz, auf dem Goldmeer der Erinnerung sich treiben lassend, und Glück überglänzte sein Gesicht, »ach«, sagte er, »schön wars heut im grünen Wald! Und tausend Rehe haben wir gesehen!« Nun, die Übertreibung, wir überhörten sie und verziehen sie ihm, wir wußten ja, wie ers meinte, Franz, der Glühende. Aber der Spätling, eine gewissenhafte Natur, ein guter Rechner, das große und das kleine Einmaleins im Kopf, aber mit sandigem Gemüt, der tadelte: »Franz, hör auf, tausend?« Der Trockenbold las, es ist zu vermuten, auch seinen Homer nicht. Franz, das weiß ich, tat es auch nicht, und war doch, bei allem sternenweiten Abstand, von seiner Artung: ein Vorstadtsänger neben einer gewaltigen Liederkehle, ein schilpender Spatz neben der Goldfäden ziehenden Nachtigall, aber ein Sänger eben doch! Die Rüge des Sandmännchens hatte ihn verdrossen, er war aus allen Himmeln geschleudert, der ertappte Dichter, und wandte sich jetzt, Hilfe und Rechtfertigung suchend, an den Mann, der mit ihm im Wald gewesen, Zorn und gerechte Entrüstung bebte in seiner Stimme, als er sagte: »Aber fünf warens gewiß! Sag selber!«
Gelächter erhob sich, donnernd, rund um den Tisch, verhallend und dann neu ausbrechend, wie bei einem zurückkehrenden Gewitter, und Franz lachte mit, und auch der Trockenbold lachte. Und das Gespräch ging weiter, gemächlichen Ganges, und hin und her, und vom Hundertsten zum Tausendsten, aber vom Wald und seinen tausend Rehen sprach Franz heute nicht mehr. Die Harfe hatte er weggestellt. Er hatte Perlen vor die Säue geworfen. Welche Übertreibung nun schon wieder: waren wir Säue?
Schnee überm Oktoberfest
Vom Oktober trägt das altberühmte Münchner Volksfest den Namen, das aber in seiner größeren Dauer schon im September gefeiert wird. Man hat es so eilig mit ihm, um dem Schnee zu entkommen, der in Oberbayern oft schon sehr früh sich zeigt, und manchmal ist der Schnee auch schneller als das Fest, das vor ihm auf der Flucht ist, und fällt in die noch voll belaubten Bäume und überfällt weiß strudelnd die bunten Zeltbauten.
So konnte man vor Jahren – wer es erlebt hat, vergißt es nicht – während der Kalender unbestechlich den grünen Herbst anzeigte, mitten im weißen Winter auf die Freudenwiese gehen. Der Schnee, großflockig zwar und wäßrig grau, zerging, sobald er den Boden erreichte, aber auf den Zeltplanen, die schräg zum Regenschild herabgerollt die Buden schützten, blieb er doch liegen und zerschmolz auch da nicht gleich, wo Schokoladenherzen, in brandrotes Papier gehüllt, mit Liebesschwüren bemalt, an feuerfarbenen Bändern baumelten. Kaum ein Mensch war zu sehen in den breiten Straßen, die sich zwischen den prunkenden Bierhallen hinziehen, wo die Fahnenstangen ihre mächtigen, weißblau gestreiften Tücher schwenken, in den oft auch lustig weiß und blau gestreiften bayerischen Schönwetterhimmel hinein, strahlend wie nur er sein kann an gnädigen Tagen – in der Trübe jetzt hingen sie naß und zerknüllt herab.
Ein großes Zelt beherbergte Männer aus dem indischen Archipel, die sich, Speere werfend und Pfeile schnellend und auch sonst kriegerische Künste treibend, dem Zuschauer zu zeigen wünschten. In den frühen Nachmittagsstunden dieses Septembertages aber, der Schneewirbel war gerade ein wenig sanfter geworden, fuhren sie, die sich sonst nur gegen Entgelt sehen ließen, auf der anderen Seite der Budenstraße auf großäugigstarrblickenden Pferden und langhalsigen, weißen Schwänen eines Karussells unentwegt im Kreise herum.
Sie trugen unter den bunten Burnussen dicke, graue und grüne Wollstrümpfe und Knickerbocker aus verwegen gewürfelten Stoffen. Einer, groß, pockennarbig, langhalsig, mit einem mächtigen, schmutzigweißen Turban um den Kopf, hatte eine weißblonde, rundliche Frau, die Besitzerin des Karussells, vor sich auf den spiegelig glänzenden Rappen mit der schön verschnörkelten Mähne genommen. Der Inder ritt jauchzend das kleine dickbauchige Tier, das, mit den schlagenden Vorderläufen in der Luft, in immer gleichem Abstand hinter den Gefährten einherjagte, in seiner gedrechselten Starrheit zauberisch lebendig. Der Leierkasten des Karussells schnarrte und grölte und zitterte leicht unter der Wucht des eigenen Atems, und war der einzige weitum, der tönte.
Die farbigen Männer lächelten im Vorüberreiten zu ihrer Bude hinüber und nickten spöttisch ihrem Ausrufer zu.
Dem Ausrufer fiel der kalte Flaum in den großen Mund, den er aber tapfer immer wieder öffnete, um die kleine Zuhörerschar, die sich vor ihm zusammengefunden hatte, zum Eintreten zu verführen. Es waren einige halbwüchsige Burschen und Mädchen, auch zwei oder drei im Winde fröstelnde Erwachsene darunter, und eine bäuerisch gekleidete junge Frau mit einem vielleicht sechsjährigen Knaben an der Hand, die es merken mußte, daß der Mann da droben vor allem zu ihr sprach, gerade ihr mit weithin schallender Stimme (und dabei stand sie ihm doch ziemlich nah, am weitesten vorn im Trupp), gerade ihr die wilden Künste der Archipelmänner anpries!
Die Frau errötete und fand es unbehaglich, so unerwartet sich ausgezeichnet zu sehen, und blickte sich verlegen nach einer Lücke im Zuhörerkreis um, durch sie zu entwischen. Da verdrossen der Frau ängstliches Gesicht und die schadenfrohen Mienen der reitenden Inder den schreienden Mann, und er brach mit einer schmerzlichen, verzichtenden Handbewegung seine Rede ab, und mit übellaunigem Gesicht verschwand er schnell in der Bude.
Der kleine Trupp der Wiesenbesucher setzte sich wieder in Bewegung. Er fiel nicht auseinander, es ging nicht jeder der Leute seines Weges, die doch gar nicht zusammengehörten, als trügen sie Furcht, allein das Abenteuer des verschneiten Festes zu wagen, und auch die bäuerliche Frau im Kopftuch blieb strengen Gesichtes bei den Genossen der Stunde, an der Hand das folgsame Kind.
An der Rückwand seines kleinen Verkaufsstandes lehnte ein schwarzlockiger Mann, der Kokosnußschnitten feilhielt, neben einem zarten, jungen Wesen in roter Bluse, das er für die vierzehn Wiesentage als Verkäuferin verpflichtet hatte, weil er der Meinung wohl war, so ein hübsches Ding brauche kein »Nein!« zu fürchten, wenn es zum Kauf einlud. Er hatte feurige, gutmütigdumme Kugelaugen, die zu seinem gelockten Schwarzhaar paßten, und er schien nicht ärgerlich zu sein, gar nicht, daß die Männer in der Stadt geblieben waren, an denen das Mädchen seine Künste hätte erproben sollen.
Er stand ganz dicht bei der Rotblusigen, es war wärmer so, und die Wärme tat gut bei diesem Wetter, und die Bretterwand erlaubte es dem Schneewind nicht, kalt in des Mädchens Nacken zu blasen. Wenn er sich drehte, der Wind, und das Tuch des Regendaches knatterte, und die an Schnüren hängenden Kokosnüsse stießen mit dumpfem Ton aneinander, stellte sich der Kugeläugige ritterlich vor das Mädchen, es zu schützen. Braun glänzten, aber seiden-fein, des Mädchens Haare, von der Farbe der struppigen Haarzotteln auf den Schalen der Früchte, und milchig und weiß wie das Fleisch der Nüsse schimmerte die atmende Mädchenhaut.
Etwas später am Nachmittag hörte es für kurze Zeit ganz auf zu schneien. Es war die Wolkendecke geborsten, schnell und unerwartet, wie sie es sonst nur im April tut, und die Straßen der Budenstadt waren blau getüpfelt, weil die Bläue des Himmels sich spiegelte im Wasser eines jeden Fußstapfentümpels. Der schweifende Trupp, der immer noch zusammenhielt, bekam jetzt Verstärkung. Er schwoll an und schob sich langsam und mit Bedacht und in einer strengen Ordnung, die keine Sehenswürdigkeit ungesehen lassen wollte, über den Festplatz. Das schwarzseidene Kopftuch der Bäuerin flimmerte in der Sonne, und an ihrer Hand das Kind, dem sie eine kleine Trompete gekauft hatte, blies immer die paar gleichen grellen Krächztöne darauf und sah dann ernsthaft der Trompete in den runden Mund, als wundere es sich, daß daher der Klang kam.
Vorn an die Rampe der Liliputaner-Bude getreten war ein kleiner Mann im Frack, einen Zylinder auf dem Kopf, mit einem gelben Gesicht, wie es Leberkranke haben, aufgedunsen und faltig, greisenhaft und jugendlich geheimnisvoll zugleich. Nun hob der Zwerg mit der gelben Kinderhand den hohen Hut und winkte, näherzutreten, und tat das, indem er hochmütig über die einzeln vorbeistreifenden Zuschauer hinwegsah.
Mit einem plötzlichen, entschlossenen Ruck dann setzte der Kindmann den Hut wieder fest auf den Kopf und begann, die Hände auf dem Rücken, die ganze Länge der Rampe feierlich und verdrießlich im Hin und Her abzuschreiten. Eine Frau, eine gewöhnliche Menschenfrau, keine Zwergin, die dick vermummt an der Kasse saß, lud mit kurzen Rufen ein, sich die berühmten Liliputaner zu besehen, aber es klang wenig zuversichtlich, als glaube sie selber nicht, daß jemand ihrer Lockung werde Folge leisten.
Es war nun gerade der Trupp der Beharrlichen vor der Zwergenbude angekommen. Der Däumling im Frack hielt inne im ruhelosen Wandern und sah scheelen Blicks zum Himmel auf, der sich schon wieder verdüstert hatte. Da schrie die Frau an der Kasse wild: »Hereinspaziert! Hereinspaziert!« und klatschte in die Hände und schrie: »Prinzessin Esmeralda!«, und aus dem Vorhang trat eine winzige Frau in einem tief ausgeschnittenen Ballkleid aus rotem Samt, die platinweiß gefärbten Haare gewellt und emporgetürmt, und auf der Haarwoge wackelnd eine goldene Krone. Der Zwerg verbeugte sich tief vor der Prinzessin, zog in gewaltigem und putzigem Bogen den Zylinder vor ihr und küßte ihr die Hand, die sie ihm mit einem gefrorenen Lächeln reichte.
»Herein! Herein!« keuchte die Frau an der Kasse, während schon wieder die ersten Flocken fielen, dann dicht und dichter kamen, wirbelnd mit einem Male, und der Wind trieb die Flocken gegen das kleine Paar, daß sich die Prinzessin das Gesicht wischen mußte.
Niemand folgte dem stürmischen »Herein«, und als der Schnee jetzt zu Regen wurde und ein Wolkenbruch niederzuprasseln begann, schob sich der Zuschauertrupp flüchtend in eine Wurstbraterei, die der Zwergbude gegenüberlag. Nur die sparsame Bäuerin ging in den Regen hinein weiter mit dem Kind, das die Trompete fest in der Faust hielt.
Leer war es vor dem Liliputanerzelt, der Regen strömte dicht und heftig herab, die Prinzessin war wieder hinter dem Vorhang verschwunden, auch die Menschenfrau hatte den Platz hinter der Kasse verlassen, nur der gelbhäutige, winzige Mann im Frack stand noch auf den regengepeitschten Brettern, und plötzlich stampfte er mit dem Fuß auf, hob seine kleine Faust gegen den Himmel, sie schüttelnd, zornig und traurig und lächerlich.
Lob der Stadt Passau
Als ich noch verliebter war in diese Stadt und vermessener in meinem Urteil und schneller fertig mit dem Wort, als ich es heute zu sein glaube, da schrieb ich wohl, daß Passau die schönste deutsche Stadt sei. Heute wage ich das von ihr so wenig zu sagen wie von irgend einer anderen deutschen Stadt im Norden und im Süden, im Osten und im Westen. Aber wenn meine Liebe heute gezügelter ist und ich vorsichtiger geworden bin und von Passau als einer der schönsten deutschen Städte spreche, so darf mich niemand der Übertreibung zeihen.
Es gibt Holzschnitte von einem alten und treuherzigen und klaräugigen Meister, von Hans Sebaldt Lautensack, der vor 400 Jahren lebte. Auf seinen vergilbten und bräunlichen Blättern sind die Umrisse von süddeutschen Städtebildern klar in den Himmel gezogen. Wie ein Netz von Strichen, ein Kreuz und Quer von Dächerkanten, von Fenstergesimsen, von Türmen und Mauern schwankt manche Stadt bei ihm tänzerisch und verwegen über dem Flußtal. So ist auch Passau anzusehen, die Stadt, von der ich nicht weiß, ob der alte Holzschneider und Kupferstecher Lautensack sie jemals vor Augen bekam: ein hüpfender Ball über Ebenen und Wäldern.
Drei Flüsse vereinigen sich rauschend ihr zu Füßen: die Donau, der Inn und die Ilz. Spiegelndes Wasser glänzt auf unvermutet hinter jedem Häuserblock, und von der breitesten der Brücken schaut der böhmische Beichtvater Nepomuk hinunter zu den silbernen Fischen.
Die Straßen steigen hurtig auf und nieder, verwandeln sich in Treppen mit moosbewachsenen, feuchten Stufen, und stürzen jäh und glitschig ab und immer steht man dann an einem Fluß. Grün und geringelt wie Wasserschlangen, die ihr Element suchen, patschen die Treppenstraßen ins Strömende. Drei Tage ist man dort, dann unterscheidet man an der Farbe des Wassers, ob es die Donau ist, der Inn oder die Ilz. Die Donau rollt breit und schwer, der Inn rasch und schäumend, die Ilz geschmeidig und behend. Und breit und schwer und rasch und schäumend und geschmeidig und behend fließen sie vorbei an den Kirchen, an den vielen Kirchen, an Domen und Kapellen mit runden und stumpfen und spitzen Türmen, mit großen und kleinen Glocken, und sie läuten am Morgen, am Mittag und am Abend. Passau ist die glockengeschwätzigste Stadt.
Von der Festung aus, die über der Stadt droht, Oberhaus heißt sie, sieht man weit ins Land hinein, über Hügel und Acker und Wasser hinweg, hinein nach Österreich sieht man, und dort, wo die Wälder wie ein grüner Wirbel zusammenschlagen, beginnt Adalbert Stifters Land.
Die Festung Oberhaus war einmal Militärzuchthaus und in vielen schwermütigen Liedern wird ihrer gedacht. Wer den Offizier mit der blanken Waffe anging, den rosigen Leutnant oder den breitschultrigen Hauptmann, in Trotz und Rausch und Jähzorn, oder wen das Heimweh verführte, der mußte hier Karren schieben, Soldat zweiter Klasse, schielend hinunter auf die goldenen Dächer.
In einer kleinen Schenke, die einem frommen Stift gehört, gibt es einen würzigen Wein. Der wächst über der Grenze auf einem Weinacker, den die Braunkuttenträger betreuen. Man schenkte in der Schenke, damals, vor Jahren, als ich dort war, nur diesen einen Wein aus und sonst nichts und garnichts sonst. Man saß am butterweiß gefegten Tisch, und schon stand das funkelnde Glas vor einem. Brot mußte man selbst mitbringen. In der Schenke gab es nur den gelben, mönchischen Wein.
Mit gemauerten Steinwänden stößt eine Insel hinaus in das viele Wasser. Mit wippender Gerte steht an der vördersten Spitze ein Angler. Der Himmel wölbt sich herab. Das viele Wasser ist wie ein See, und Himmel und Erde verrinnen in eins, und der Angler angelt nach Fischen und Sternen.
Ob der alte Stecher und Holzschneider Hans Sebaldt Lautensack die Stadt Passau jemals vor seine leiblichen Augen bekam, weiß ich nicht. Sein Nachfahr Heinrich Lautensack, der Dichter, der im Jahr 1918 im Wahnsinn in München starb, dessen Andenken heut fast verschollen ist, der ist hier in der Nähe geboren, und lebte jahrelang in der Dreiflüssestadt und kehrte immer wieder zu ihr zurück. Er war zuhaus hier, in dieser krausen und schroffen und lieblichen Landschaft, wie sie auf Abbildungen der Donaumeister, des Augustin Hirschvogel, des Wolf Huber und des großen Albrecht Altdorfer ein zaubermächtiges Leben führt, mit Kalkfelsen und Stromdurchbrüchen und wehendem Strauchwerk und einem wolkenüberflogenen Himmel. Seine Gedichte sind stark und würzig und ein wenig mönchisch auch wie der Schoppenwein in der kleinen Schenke, und gelbfunkelnd und prächtig und zierratreich wie die Arbeiten eines anderen Ahnen von ihm, des Goldschmiedes Lautensack, von dem Goethe berichtet, daß er »ein geschickter, munterer Mann war, der wie mehrere geistreiche Künstler selten das Notwendige, gewöhnlich aber das Willkürliche tat, was ihm Vergnügen machte«. Und ein wenig so war Heinrich Lautensack wohl auch, der Dichter des »Hahnenkampfs« und des »Gelübdes« und der so verlästerten und geschmähten und doch so heiterfrommen »Pfarrhauskomödie«.
Von kurzem, grünem, hellgrünem Stoppelgras beflaumt steigt die Anhöhe sanft auf. Da liegt Heinrich Lautensacks Haupt. Schmerzlich grinst sein geöffneter Mund: eine bräunliche Kiesgrube. Bäume, buschig, blätterwuschlig, stehen im Halbbogen wie Augenbrauen. Abgetrennt liegt sein Kopf vom Rumpf, wächst zusammen mit der Landschaft, und wie eine freche, stechende, stachlige Nase mit nach oben stehenden Nasenlöchern erhebt sich ein Grasbuckel in der Mitte des Hanges. So sieht um die Abendröte weinrot des Dichters Kopf über die bayerische Stadt.
Ein hoher Baum, eine kahle Föhre, sonnt sich am Erdbeerhügel. Eidechsen rascheln unten, die nackte Föhre wiegt sich im Juliblau. Es ist ein schwarzer Abdruck von der braunen Kupferplatte, aber das Juliblau, das über der Föhre glänzt, das tiefe, tönende, wankende Blau ist doch deutlich zu sehen. Hinter dem Hügel beginnen die Wälder, die scharrenden, dunklen, böhmischen Wälder. Nur die froschnackte Föhre ist auf die Platte gesprungen, voreilig, zu früh, und brät nun allein in der hitzigen Einsamkeit ihres Vorpostens. Denn nach Passau darf sie doch nicht hinein, dieser Stadt, schwankend und tänzerisch überm Dreiflüssetal, dieser federnden, hüpfenden Stadt auf der braunen Platte des alten Lautensack. Und aus den Versen des jungen Lautensack strömt der Duft dieser Landschaft zu mir her, und den funkelnden Schoppen halt ich hinauf, empor zum Oberhaus, hinüber ins Adalbert-Stifter-Land, schwenk ihn und schütt ihn hinab zu Donau und Inn und Ilz.
Als ich noch verliebter war in diese Stadt, und vermessener, ja, frech in meinem Urteil und überaus schnell fertig mit dem Wort, da ließ ich wohl drucken, daß Passau die schönste deutsche Stadt sei. Aber wenn meine Liebe heute gezügelter ist und ich vorsichtiger geworden bin, vielleicht zu vorsichtig, ja, leisetreterisch, und ich von Passau als von einer der schönsten deutschen Städte spreche, wer dürfte mich da der Übertreibung zeihen; wer?
Regensburg
Die Donau ist blau, blaugrün, blaugrün wie der Streifen Westhimmel am Abend nach Sonnenuntergang, manchmal grün wie helles Moos, im Spätherbst gelb, und gelb im Vorfrühling, wenn die Schneewasser kommen. Aber jetzt, im Juni, im Juli, flattert sie wie ein glänzendes, windbewegtes Band über die Ebene. Weit draußen, sehr weit draußen, im Westen der Stadt, wo Wälder eilig und schwarz hereinsteigen, steht der lichtflimmernde Riese, der die Schnur wirft, der das Band schwingt, das sich kraus um den Häuserblock legt, in einem frechen und schnellen Bogen ihn umschnörkelt und das geschlängelt und fern blitzend in den östlichen Wiesen und im graublauen Himmel verläuft und vergeht. Das Donauband, das blaue, verweht, aber die schwere Stadt bleibt stehen, auf der grünen Fläche aufgestellt, zu dauern. Und mit den zwei Fingern der Domtürme weist sie zum Himmel, unerschütterlich zum Himmel, zum niemals wankenden.
Die alte, steinerne Brücke führt über die Donau, nicht schnell und hitzig wie die neuen Eisenstege, nicht in kühnen Bogen und gewagten Kurven, sie geht schwer und bedächtig hinüber, auf den steinernen Pfeilerschuhen, aber hinüber geht sie und kommt an, kommt gerade so gut an wie die hurtigen Springer von heute. Vom Ufer tut sie den ersten Schritt, dann brummen die Wellen um ihre Steinfließenfüße, und dann ist sie drüben, in Stadtamhof, einem kleinen Städtchen, das wie eine Warze an dem großen Gesicht der größeren Stadt hängt.
Hinter Stadtamhof steigt ein Hügel auf, ein Berglein, das sich Dreifaltigkeitsberg nennt, und von dort ins Donautal zu schauen, wie schön! Da ist eine weite, große, flache Tellerebene, mit Wiesendreiecken und Felderquadraten, und auf dem Teller steht Regensburg, und die Donau blitzt, und der Fluß läuft weiter, nach Osten, und da schieben sich grüne, niedrige Berge an ihn heran, die wie brave, stumme, treue Tiere sind, wie große Hunde ohne Gebell sich lagern. Und darüber ein blauer Junihimmel, mit ein paar weißen, milchweißen, milchgelben, rahmgelben Wolken, die sich im Strom abmalen, aber das sieht man nicht von hier aus, vom Dreifaltigkeitsberg aus, das ahnt man nur. Und nun könnte man wie ein Adler, aber der Vergleich ist zu großartig, aber immerhin könnte man wie ein Falke, oder sagen wir wie ein Habicht im blauen Himmel mit gespreiteten Flügeln über der Stadt schweben, ohne die Flügel zu rühren, unbeweglich, und spähen. Tief unten, eingegraben, eingeschnitten, schwarz wie Maulwurfsgänge laufen die Straßen und Gassen. Nun tiefer hinab! Die Straßen wandeln sich zu springenden Fischen, silbrigen, aus dem Nassen geholt und aufs Trockne geworfen, und nun zucken und winden sie sich, und das Pflaster, die vielen weißen, runden, kleinen Pflastersteine sind wie Schuppen, die glänzen und gleißen, und die Fische zappeln wie aus einem Korb geschüttet, über- und unter- und durcheinander. Noch tiefer hinab, Falkenflügel und Habichtschwinge! Da stehen die Häuser, viele Häuser, graue und weiße und rosafarbene und grüne, und viele Türme, hohe und niedrige, eckige und runde, mit Zinnen und Ziegeldächern, und Kirchen, viele Kirchen, sehr viele Kirchen, kleine, kapellenähnliche, und große, schwere und eine ganz große, der Dom, der riesige Dom, in dessen Schatten Regensburg dämmert. Um die Domtürme, um die beiden Domtürme fliegen kreischend und schwarzflügelschlagend die Dohlen und scheuen den Habicht, den Falken und bergen sich in den großen Steinblumen, im Helm der heiligen Ritter und Könige, im Faltenwurf der Propheten und Apostel.
Aber abgeschnallt den Falkenflügel, die Habichtschwinge! Zu Fuß nun auf zwei rüstigen Beinen durch ein steinernes Tor, durch einen gepflasterten Wirtshausgarten in eine kleine, braune, dunkle Trinkstube mit vier Tischen. Da ist’s kühl und braundämmernd und an der Wand hängt ein Hausaltar und am Tisch gegenüber, hocken da nicht im schwarzen Kleid die Domdohlen, mit nackten Gesichtern und klugen Augen? Auf dem Tisch steht ein kleines Schild und auf dem kleinen Schild steht mit schwarzen Buchstaben geschrieben: Nur für die Herren Geistlichen. Rund um den Tisch sitzen sie geplustert, die schwarzen Röcke glänzen, hagere Gesichter, fette Gesichter, dumme Gesichter, kluge Gesichter, kämpferische Gesichter und milde. Das ist die Pfarrstube im Wirtshaus »zum Bischofshof«, und die Brauerei und die Wirtschaft unterstehen dem Bischof von Regensburg, und die Pfarrervögel fliegen ein und aus, und wenn ein schwerer Prälat eintritt, erheben sie sich schwankend, die Rockschöße wehen, und dann sitzen alle beruhigt wieder an der länglichen Tafel, an der das Gespräch geht, ruhig, heiter, und mit der Miene von Leuten, die eine Sicherheit, eine Gewißheit, eine Bürgschaft in Händen halten wie einen schweren goldenen Krug und ihn zu heben wissen mit Anstand und ihn seit hundert Jahren und hundert Tagen halten und weitergeben, und fallen läßt ihn keiner.
Und gehst du aus der Trinkstube und machst sieben Schritte auf den Pflasterhof, wo Kastanienbäume stehen mit roten Juniblütenkerzen, sieben auf jedem Ast, und du siehst zu den Kerzen hinauf und siehst höher in den Abendhimmel, so ragen rosig beleuchtet wieder zwei Riesenkerzen, zwei Domtürme, denn du kannst nirgends hingehen in Regensburg, wo du den Dom nicht näher sähst.
Und dann lauf in die Abendgassen hinein, über Plätze und durch Tore, und wenn du willst, siehst du blühend und prall und nie gestorben ein unsterbliches Gesicht: das Mittelalter. Süßes, funkelndes Mittelalter, da Karl, der mit der dicken Unterlippe, sich in die schöne Regensburgerin Barbara Blomberg vergaffte und einen hitzigen Sohn mit ihr zeugte, in Regensburg zeugte, der bei Lepanto die Seeschlacht schlug, den der Papst segnete und der Don Juan d’Austria hieß und von dem eine Tafel an einem großen Haus erzählt. Starkes und gewaltig kunstfrohes Mittelalter, da der große Albrecht Altdorfer hier malte, und die Donaulandschaft und das Goldgrün der Donauwälder ihn nicht mehr losließ, daß er es immer malen mußte, das Gold und das Grün, daß seine Bilder heute noch brodeln davon. Laubwolkig, geschwungen, breitwehend wölben sich die Wipfel, im Lufthauch zitternd, im Wind rauschend, in der Sonne strahlend, goldgetupft, gelbgesprenkelt, lichtgeädert, schillernd wie Forellenhaut.
Altdorfer ist tot und der dicklippige Karl, aber die Altdorferwälder glühen und brennen noch und dröhnen schattig in der Sonne und die Stadt steht noch und das Fronleichnamsfest – man feiert es wie von je! O Kinderzeit! Schon früh erwacht, und in den neuen, schwarzen Anzug und ein Sträußchen ins Knopfloch und auf die Straße! Da ist Heu auf alle Gassen gestreut und Birken stehn an den Häusern, und rote Decken, Purpurschabracken, hängen aus den Fenstern und das Heu duftet so stark und berauschend, daß man taumelnd zur Kirche läuft. Und das Heu ist grün, und die Birken sind weiß und grün, und weiß sind die Leinenhosen der Soldaten, die Spalier stehen, weiß sind die Talare der Pfarrer und der singenden Chorknaben, und golden ist das Kleid des Bischofs. Aus Gold ist die Monstranz, die er mit brokatnen Armen hochhebt, und die Glocken läuten und die Priester singen und die Knaben und Mädchen beten Litaneien. Das Heu duftet und der Weihrauch wirbelt und aus allen Wirtschaften kommt der bäurische und bayrische Geruch von Bratwürsten. Das ist Verzauberung, das ist ein heidnisch-frommer, schlaraffischer Tag!
Denn natürlich gibt es den Mond überall, in allen Erdteilen, in Afrika und in Asien, in den Städten der weitesten Welt, aber ist er je so riesig und rot aufgegangen wie in Regensburg? Der Sommertag ist noch nicht ganz vorbei, noch ist das Silbergrau der Dämmerung in der Luft und im Westen, wo die Sonne hinabging, rotbrüllend, ist noch ein tiefes Grün. Da glüht es hinter dem Scheuchenberg auf, das Rot nimmt zu, es flammt, eine mächtige, blutorangenrote Kugel rollt herauf, der Mond. Du fürchtest dich, und klammerst dich am Steingeländer der Brücke fest, und spreizest die Beine, um fest zu stehen, und wagst es, die Feuerkugel zu betrachten. Aber es ist keine Kugel, siehst du beim Längerbeobachten, es ist eine Scheibe, eine Scheibe, aus einer Blutorange herausgeschnitten, gelbrot, gelbfeuerrot, von einem kriegerischen Glanz. Aber dann wird das Rot gedämpfter, es verblaßt, und die Scheibe steigt höher und wird nun gelb, und wie sie gelb wird, wird sie kleiner und Sterne stehen um sie herum und das bläuliche Mondlicht fließt über die Donau, über die Stadt, über die Brücke. Von unten rauscht der Strom herauf. Grün sieht er aus, und wo er sich an den Pfeilern bricht, schäumt er weiß, und je höher der Mond steigt, um so stiller wird’s und um so lauter redet die Donau. Die Stadt steht kohlschwarz im Licht, mit so scharfen Konturen, so überscharfen, rasiermesserschneidigen, daß man denkt, die Katze, die über den Dachfirst rennt, könnte von der Schärfe der Dachlinie zerschnitten werden und geteilt, halbiert aufs Pflaster schmettern. Um Mitternacht fangen die vielen Uhren in den vielen Türmen die Zeit zu schlagen an, in dumpfen und groben Schlägen, in schnellen und hellen, in Baß und Sopran. Und die Katze sitzt unzerschnitten auf dem Dach, schwarz gegen den mondblauen Himmel, und horcht auf das Uhrenschlagen und krümmt den Katzenrücken und ringelt den Katzenschwanz. Der Mensch auf der Brücke klatscht in die Hände. Noch verwegener buckelt die Katze, läuft wie ein Seiltänzer den Dachfirst entlang und verschwindet schwarz in einer schwarzen Dachluke. Unbeweglich und gelb sieht’s Mond.
Editionsnotiz
für die Prosabände 7 bis 16.
Als Druckvorlage diente diesen Bänden die Ausgabe »Georg Britting – Gesamtausgabe in Einzelbänden« der Nymphenburger Verlagshandlung, München.
Zu den Bänden 13, 14 und 16:
Diese Bände enthalten die Beiträge des Bandes „Anfang und Ende“ der zuvor genannten Ausgabe, der nach dem Tod von Britting im Jahr 1964 erschien und folgende Nachbemerkung enthält: Mit diesem Band ist die Gesamtausgabe der Werke Brittings abgeschlossen.
Sechs Bände sind vom Dichter in den Jahren 1957 bis 1961 noch selbst redigiert worden, sozusagen als Ausgabe letzter Hand. 1965 erschienen und dem Titel »Der unverstörte Kalender« [Band 6 unserer Ausgabe] zunächst die Gedichte aus dem Nachlaß. Nunmehr wird der erzählerische und dramatische Nachlaß Brittings in Buchform zusammengefaßt. Wie schon der letzte Gedichtband, enthält er Werke aus allen Schaffensperioden: zunächst Erzählungen, sodann Bilder, Skizzen und Feuilletons, [unser Band 13] die Britting bisher in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht hatte, das Fragment eines größeren erzählerischen Werkes aus der Spätzeit, »Eglseder« [unser Band 16] und schließlich drei dramatische Arbeiten aus den zwanziger Jahren. [Unser geplanter Band 14] Das dichterische Werk Georg Brittings liegt damit, abgesehen von einigen wenigen peripheren Arbeiten, in acht Bänden vollständig vor.
Ausführlichere Informationen unter: www.britting.de
Impressum
Band 13
Hrsg. von Ingeborg Schuldt-Britting
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar. Informationen über den Dichter und sein Werk in www.britting.de.
Alle Rechte vorbehalten
© 2012 Georg-Britting-Stiftung
83101 Höhenmoos
Wendelsteinstraße 3
Satz u. Layout: Hans-Joachim Schuldt
Made in Germany
Gedruckte Taschenbuchausgabe:
ISBN 978-3-9812360-0-2 (Sämtliche Werke – Prosa)
ISBN 978-3-9812360-7-1 (Anfang und Ende)
